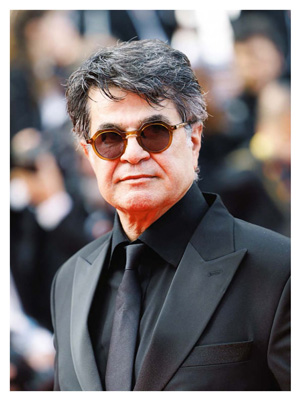Annika Ross: Bin ich angekommen?
„Für’n Wessi bist du ganz in Ordnung!“ Was als Kompliment gemeint ist, kommt bei mir immer noch als kleine Unverschämtheit an. Als wären Ossis die besseren Menschen, weil sie ja so viel bodenständiger, verlässlicher und sozialer sind. Soweit das Selbstbild. Seit 17 Jahren lebe ich nun in Leipzig, als Wessi unter Ossis. Und obwohl ich mich ziemlich ossimiliert habe – ich ziehe mir beim Betreten der Wohnung sofort die Schuhe aus, stelle mich brav in die Reihe und nenne die Uhrzeit auf Ostdeutsch (viertel nach acht ist hier viertel neun) – spielt meine Westvergangenheit noch immer eine Rolle.
Nach meinem Studium begann ich ein Volontariat bei der Leipziger Volkszeitung. Eine Etappe führte mich für ein Jahr nach Altenburg, etwa 50 Kilometer entfernt von Leipzig, zurzeit im Gespräch, weil die Kleingärtner von dort gegen Claus Kleber zu Felde ziehen. Egal, wohin ich auch kam, die Frage nach meiner Herkunft tauchte sofort auf. „Ssie sin’ abor nisch von hier, odor?“ hieß es lauernd, und ich merkte oft, wie sich eine Mauer in den Köpfen auftürmte. Auch innerhalb der Redaktion musste ich erst einmal beweisen, keine arrogante West-Tussi zu sein. Denn unter diesen Generalverdacht wird Westfrau sofort gestellt.
Als ich einmal mit drei Kollegen zur Druckerei fuhr und ein Auto vor uns auf die Autobahn schlich, witzelten zwei von ihnen „Typisch Frau am Steuer“. Ich bemerkte aus Spaß nur „oder Ossi“ und prompt fühlten sich alle drei von der arroganten West-Tussi auf den Schlips getreten. Nach ein paar Monaten war ich trotzdem – wahrscheinlich wegen meiner Dorfvergangenheit – akzeptiert und wurde oft mit dem Pioniergruß und den Worten „Freundschaft“ empfangen.
Bevor ich zum Studium nach Leipzig kam, hatte ich über den Osten ehrlich gesagt nie großartig nachgedacht. Tief im Westen, noch dazu im verträumten Emsland, war der Osten weit weg. In meiner Schule hing (auch nach der Wende noch) eine Deutschlandkarte mit der innerdeutschen Grenze und irgendwie war alles dahinter wie ein blinder Fleck. Für viele Menschen aus meiner Heimat ist das heute noch so. Als Journalistin hat man ja das Glück in das Leben vieler Menschen und ihre Geschichten einzutauchen. So habe ich ein Stück DDR kennengelernt.
Am beeindruckendsten empfinde ich oft die Biografien der Ost-Frauen, deren Leben sich komplett geschüttelt und die trotzdem nicht den Halt verloren haben. Mit dem Sozialismus haben sich auch viele Ehemänner verabschiedet, um im Westen ein neues Leben anzufangen. Die Frauen blieben oft alleinerziehend zurück. Auch verloren viele ihre Jobs, weil es plötzlich unerwünscht war als Frau auf dem Bau, in der Landwirtschaft oder als Ingenieurin zu arbeiten. Diese Frauen erschüttert heute so schnell nichts mehr. Schon gar keine Besserwessis.
Viel härter in Sachen Klischees trifft es meist eh die Westmänner, die bei unsozialistischem Verhalten sofort zum „Dreckswessi“ werden. Ein Wort, das übrigens längst noch nicht aus der Mode gekommen ist. Ossis bilden dann ganz schnell eine Gruppe. Da merkt man sofort die Solidarität. Den Hass auf eine gewisse Überheblichkeit kann ich dabei sogar verstehen. Auch wenn ich als Emsländerin diese Art kollektive Ablehnung eigentlich nur in Verbindung mit Holland und Fußball kenne und das auch eher Folklore nennen würde. Während eines Kanada-Urlaubs fragten mich zwei Schwaben, wo ich denn herkäme. Auf meine Antwort Leipzig sagten sie: „Isch des net schee, dass ssie da jetzt so verreise dürfe?“ Das war 2013.
Als ein Wessi-Kollege, der ständig wegen seiner Herkunft befrotzelt wurde, einmal sagte: „Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wir sind doch ein Volk. Und ihr auch.“, herrschte hingegen großes Schweigen. Diese Mauer hat er nie mehr eingerissen.
Mein Freundeskreis hat genauso viele West- wie Ostanteile. Über die Jahre sind tiefe Beziehungen entstanden und anders als viele unserer Mitmenschen können wir über Ost-West-Animositäten und vermeintliche Klischees aufrichtig lachen. Die Ossis in meinem Alter waren die letzten Kinder der DDR. Die meisten von ihnen waren um die zehn Jahre alt als die Mauer fiel, und ihre Eltern sehr froh darüber.
Aber die DDR liefert auch verdammt gute Geschichten. Eine Freundin von mir aus Mecklenburg-Vorpommern kam im Panzer zur Welt! Als bei ihrer Mutter die Fruchtblase platzte, tobte ein Schneesturm, der jedes Autofahren unmöglich machte. Da die Familie in der Nähe des Ratzeburger Sees, also in Feindesland-Nähe lebte, waren stets Grenzsoldaten und ein Panzer zugegen. Und letzterer war der einzige, der es durch den Schnee zum Krankenhaus schaffen konnte. Der Ladeschütze erwies sich als 1a Geburtshelfer, Mutter und Kind erlebten eine schnelle, unproblematische Geburt. Meine Freundin wuchs dann aber sehr pazifistisch auf.
Meine Freundinnen aus dem Osten halten sich allesamt für selbstbewusst, manchmal auch für emanzipiert, aber bitte niemals für feministisch. Feminismus ist für sie so ein Wessi-Ding, das im Osten keine Berechtigung hat. Auch Angela Merkel brach fast ein Zacken aus der Krone, als sie beim Frauengipfeltreffen im April vergangenen Jahres gefragte wurde, ob sie Feministin sei. Für alle anderen Teilnehmerinnen war das selbstverständlich, gehörte gar zum guten Ton. Der Feminismus hat im Osten einfach ein schlechtes Image. „Noa, meyne Muddi hat ja ooch immer gearbeided“, heißt es dann. Den Haushalt und die Kinder haben die Muddis übrigens gleich mitgemacht, und in Führungspositionen schafften es auch kaum welche von ihnen.
Aber es stimmt schon, allein durch die Tatsache, dass Frauen zu DDR-Zeiten in nahezu allen Berufen, eben auch als Kranführerin, gearbeitet haben, haben sie im Berufsleben einen anderen Stellenwert. Daher verwundert es auch nicht, dass im Osten weit mehr Frauen in Führungspositionen anzutreffen sind als im Westen. Meine männlichen Kollegen haben alle kein Problem mit einer weiblichen Vorgesetzten („Häubtsoche, sie is von hier!“ natürlich), auch sind viele Männer nicht so kleine Paschas wie ich sie in der Heimat noch oft antreffe. Und sie fühlen sich meist nicht in der Ehre gekränkt, wenn ihre Ehefrauen die besseren Jobs haben.
Und noch etwas. Ich fürchte, Wessis sind verschwenderischer. „Des gann man doch noch geprauchen“ ist so ein Satz, den ich hier ständig höre und eigentlich nur von meinen Großeltern kenne. Eine Nachbarin sammelt sogar „Plasteflaschen“ vom Waschmittel, weil sie sie irgendwann nochmal „verbasteln“ will. Der ganze Keller ist voll davon. „Plaste“ ist übrigens das Ossi-Wort schlechthin. Wer „Plastik“ sagt, outet sich sofort. Wenn das Haltbarkeitsdatum von Lebensmitteln länger abgelaufen ist, dann schmeiße ich sie weg, ungeöffnet. Alle meine Ost-Freundinnen sehen das anders. Eine geht sogar so weit und schiebt angeschimmelte Sachen ihrem Mann mit den Worten unter „Nua, doa stürbt der nisch tran.“
Ein bisschen anders wird mir bei Dingen wie der „Töpfchenrunde“, die unsere Tagesmutter mit den Kindern veranstaltet. Als ich meinen Sohn einmal verfrüht abholen wollte, saß die Bande gerade auf dem Töpfchen und durfte erst aufstehen, wenn „was drin ist“. Zudem ist es für viele meiner Freundinnen aus dem Osten ein echtes Ziel, ihr Kind so schnell wie möglich trocken zu kriegen. Und manchmal fehlt ein wenig die Sprachsensibilität. Hin und wieder fällt hier tatsächlich noch das Wort „Neger“, von gebildeten Leuten in nicht rassistischen Kontexten. Der Sauna-Wellnesspark „Kristall“ in Bad Klosterlausnitz lud einmal ausgerechnet am 9. November zur „romantischen Kristall-Nacht – und es dauerte ewig bis es jemandem auffiel.
Aber im Großen und Ganzen bin ich weder Ossi noch Wessi, sondern einfach deutsch. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich in internationalen Gruppen, etwa auf Pressereisen unterwegs bin. Ich bin weder die große RomantikerIn, noch liebe ich das Risiko. Ich bin pünktlich, schweige im Fahrstuhl, lege Wert auf gutes Brot und finde gern das Haar in der Suppe. Und für den Notfall habe ich meine Trekkingjacke dabei. Freundschaft!