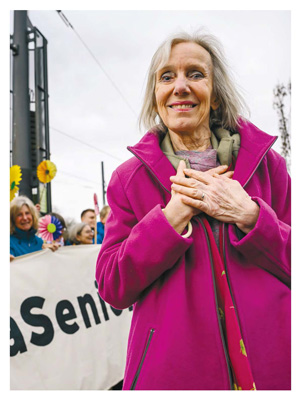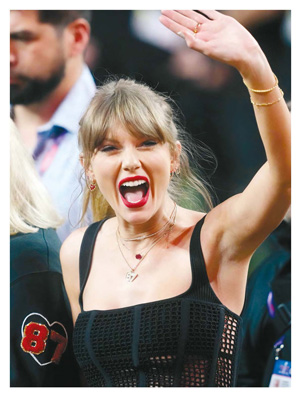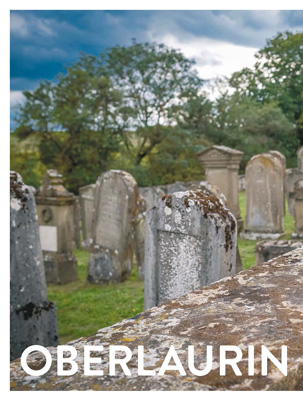Zur Sache: Die armen Männer
Wenn sie schon den ganzen Tag zu Hause ist, dann verstehe ich nicht, warum sie nicht aufräumen kann und im Flur dieses Scheiß-Legoteil rumliegt, das ich mir in den Fuß gerammt habe.“ Das ist bei unserem abendlichen Treffen die Antwort meines guten Freundes Jochen auf meine Frage, warum er humpelt. Und mit diesem unspektakulären Satz sind wir auch schon mittendrin in einem zeitgemäßen Problem.
Dieses lässt sich in etwa so zusammenfassen: Viele Frauen ziehen sich auf die Position zurück, gar keiner Erwerbstätigkeit nachgehen zu können, weil die Aufzucht ihrer Kinder bereits ein Vollzeitjob sei. Damit weisen sie, ganz wie Muttern, dem Mann die Rolle des alleinigen Versorgers zu, allerdings oft ohne die Gegenleistung einer Nur-Hausfrau zu erbringen. In der Generation unserer Eltern hat Mutti nämlich die Legobausteine und auch den ganzen anderen Kram der Kinder aufgeräumt, und zwar bevor Papa nach Hause kam. Der sollte nach einem langen Arbeitstag einen entspannten Feierabend haben.
Diese klare Aufgabenteilung mutet aus heutiger Warte zwar altbacken an, aber sie hat funktioniert. Dass ein solches Szenario für Frauen im 21. Jahrhundert nicht mehr unbedingt einen erstrebenswerten Lebensentwurf darstellt, ist verständlich. Aber eine echte Alternative dazu haben wir noch nicht erfunden. Und zur Zeit machen es sich sehr viele Frauen doch eher einfach.
Gut ausgebildete Frauen definieren sich nun ebenfalls über die Funktion, die sie in der Gesellschaft einnehmen (konnten), sind aber natürlich weiterhin Ehefrauen und Mütter (oder auch immer häufiger nicht, aber das ist ein anderes Thema). Frauen bekommen heutzutage auf allen Ebenen Zutritt zu nahezu allen beruflichen Bereiche (wie weit sie es jeweils bringen und was sie aus diesen Möglichkeiten tatsächlich machen, steht auf einem anderen Blatt), und erstmals in der Geschichte führen sie ein Leben, wie es bislang nur Männern möglich war: ein Leben mit einem Und. Sie können Frau sein und Anwältin, Frau und Tiefbauingenieurin usw.
Wenn sie dabei jedoch auf Kinder nicht verzichten wollen, dann haben sie einen Haufen Probleme, die dieses und mit sich bringt.
Und trotz dieser realen Doppelbelastung der berufstätigen Frauen: Die gerne übersehenen Leidtragenden bei diesen Verwerfungen und Verschiebungen sind die Männer. Wir sollten deshalb endlich aufhören, ihnen noch mehr zuzumuten. Denn was wir momentan von den Männern verlangen, können sie nach menschlichem Ermessen kaum leisten.
Sie sollen ihre Familien allein versorgen, aber auch nahezu rund um die Uhr für sie da sein. Wir Frauen verlangen von ihnen den vollen Einsatz an Geld, Arbeitskraft und Zeit. Und wir haben ihnen in den letzten paar Jahren immer mehr Aufgaben zugeschoben, an deren Fülle und Vielfalt sie nur scheitern können. Zumal wir ihnen kein attraktives Gegengeschäft dafür anbieten.
Jochen – der Mann mit dem Legostein im Fuß – ist ein Familienvater aus dem Bilderbuch und lebt von außen betrachtet in der perfekten Idylle: drei wohlgeratene Jungs im Alter von sechs, acht und zwölf Jahren, eine nette Frau, ein Reihenhaus in einem aufgeräumten Vorort und ein wirklich guter Job als Wirtschaftsanwalt. Jeden Abend fährt Jochen mit der S-Bahn aus der Innenstadt zu seinem Vorortbahnhof, radelt von dort querfeldein nach Hause, deckt den Tisch, isst mit Sibylle und den Kindern zu Abend, bringt die beiden Kleinen ins Bett und macht mit dem Ältesten die Hausaufgaben oder spielt im Sommer noch ein bisschen Fußball mit ihm vorm Haus. Manchmal erledigt Jochen auf dem Nachhauseweg die Einkäufe oder kocht sogar am Abend.
Danach radelt er zurück zur S-Bahn und fährt nochmal für mindestens drei Stunden in die Kanzlei. Wegen der umfangreichen Akten und den Bergen an Unterlagen, die jeder einzelne Fall erfordert, ist dieser Job im home office nämlich nicht zu erledigen.
In Jochens persönlichem Lebensentwurf waren ein anspruchsvoller Beruf und eine Familie durchaus vorgesehen. Nicht Teil des Plans war hingegen, dass die gut ausgebildete Sibylle sofort nach dem ersten Kind nicht mehr in ihre Arbeit zurückkehrt. Ebenfalls nicht geplant war, dass sie sich nach dem dritten Kind und im mittlerweile zehnten Jahr, in dem sie nicht mehr in ihrem Beruf gearbeitet oder sich darin fortgebildet hat, seit insgesamt 13 Jahren zum Familieneinkommen nichts beisteuert, sondern anscheinend vollständig in ihrer Rolle als Hausfrau und Mutter aufgeht.
Dies nicht, ohne gewaltige Ansprüche zu stellen, was Sibylle als „Gegenleistung“ bezeichnet, die Jochen ihr angeblich schuldig ist: eine Putzfrau und ein Gärtner; ein neuer Saab-Kombi, um die Kinder zum Klavierunterricht, zu Freunden und zum Hockeytraining kutschieren zu können; Klamotten, Handtaschen, Schuhe, Sonnenbrillen von Prada und Gucci; Sommerurlaub auf den Malediven und Skifahren in Gstaad; Friseur, Maniküre, Pediküre, Pilates, Yoga, Massagen, Ayurveda, Fitnesstrainer. Und das alles, weil man schließlich nicht aussehen will wie eine Hausfrau aus einem Vorort, auch wenn man genau das ist – und dazu noch freiwillig und gerne. Zu diesen materiellen Ansprüchen gesellen sich die immateriellen, ideellen Forderungen an Jochen.
„Ich will, dass wir eine Familie sind, die am Wochenende zusammen etwas unternimmt. Und ich will, dass du rechtzeitig nach Hause kommst, so dass wir gemeinsam zu Abend essen und die Kinder zu Bett bringen. Ich will, dass du weißt, was deine Söhne in der Schule gerade durchnehmen oder ob ihr Hockeyteam am Samstag gewonnen hat. Du darfst ihre Kindheit nicht verpassen, die kommt nämlich nicht wieder.“
Irgendwie kann man das sogar verstehen und schuldbewusst knickt Jochen ein. Denn die Fehler seines Vaters, der zwar die Familie ernährte, aber sein Leben im Büro verbrachte, will er nicht wiederholen. Und auch Sibylle wollte nicht werden wie ihre Mutter, weswegen sie ein Ingenieursstudium erfolgreich abgeschlossen hat, dann ein knappes Jahr lang in ihrem Beruf tätig war - und seither doch genau so lebt wie ihre Mutter in den sechziger und siebziger Jahren: als hauptberufliche Hausfrau mit drei Kindern.
Der Unterschied ist, dass Sibylles Mutter mit ihrem Schicksal nicht haderte und den Hausfrauenjob zu einer gewissen Perfektion brachte.
Männer wie Jochen ziehen täglich den Kürzeren, wenn es darum geht, Familie und Beruf irgendwie unter einen Hut zu bringen. Plötzlich – und auch das erstmals in der Geschichte – verlangt man ihnen ab, Ernährer und Erzieher zu sein. Sie sollen die Familie versorgen, sie aber auch umsorgen. Die uralte Rollenverteilung funktioniert nicht mehr, weil die Frauen nun auf der Habenseite lautstark verlangen, dass die Männer für sie und die Kinder „da sein“ müssen, auf der Sollseite aber nicht bereit sind, zum Familieneinkommen etwas beizutragen oder –auch das wäre ja denkbar – das Erziehungs-und Aufzuchtsgeschäft wirklich voll und ganz auf sich zu nehmen.
Und so sitze ich alle paar Monate spätabends mit Jochen im Biergarten oder im Wirtshaus und höre mir an, dass er nicht mehr ein noch aus weiß, da er wortwörtlich nicht mehr eine Minute seines Lebens für sich hat und immer mehr Geld verdienen muss, um noch alle familiären Bedürfnisse befriedigen zu können. Sibylle weigert sich währenddessen standhaft, eine eigene Einnahmequelle aufzutun, vermisst aber die Selbstverwirklichung in ihrem Leben. „Ich kümmre mich um die Kinder, das ist der Deal“, sagt sie zu mir, aber diesen Pakt hat sie mit ihrem Mann explizit nie geschlossen.
„Ich weiß auch nicht“, sagt Jochen, „ich habe eine selbstbewusste, attraktive Frau mit einem tollen Job geheiratet. Und jetzt habe ich seit Jahren eine Vollzeitmutter zu Hause sitzen, die mir abends erzählt, welchen Dialog sie mit der Kassiererin im Supermarkt hatte, weil das der Höhepunkt ihres Tages war. Im selben Atemzug jammert sie mir das Ohr voll, dass sie sich intellektuell unterfordert fühlt und sich gerne beruflich verwirklichen würde.“
Das „Etwas für mich tun“ dieser Frauen– vom Freundinnenwochenende auf Fuerteventura bis zur beruflichen Weiterbildung – bringt nur leider kein Geld in die Haushaltskasse, sondern kostet welches. Weswegen der Ernährer der Familie tunlichst zusehen sollte, dass er so viel leistet, dass er bei der nächsten Gehaltserhöhung, Bonuszahlung oder Beförderung entsprechend bedacht wird. Um mehr zu leisten, muss er aber wiederum mehr arbeiten, was bei Sibylle eine Kaskade an Beschwerden auslöst: „Jochen geht fast jeden Abend nach dem Essen zurück ins Büro, manchmal ist er dort sogar am Wochenende und noch spätabends wird das Laptop eingeschaltet oder er checkt Mails auf dem Blackberry. Sogar im Urlaub! Ein Mann muss doch für seine Familie da sein!“ Und so schraubt sich die Spirale der gegenseitig nicht mehr erfüllbaren Erwartungen für beide Seiten immer weiter nach oben.
Frauen in Deutschland werden seit vier Jahrzehnten immer unglücklicher. Glück oder Unglück ist ein sehr subjektives Gefühl, aber sie sind es im Vergleich mit den Männern (siehe unter anderen die große Studie der beiden Professorinnen Betsey Stevenson und Justin Wolfers, „The Paradox of Declining Female Happiness“). Ob dieser Niedergang des weiblichen Glücks seine Ursache darin hat, dass Frauen die ganz großen Räder in beruflichen, politischen, gesellschaftlichen Funktionen in der Mehrzahl doch nicht drehen; oder ob der von vielen gewählte freiwillige Rückzug ins Häusliche schuld ist; oder die freiwillige Kinderlosigkeit – wir wissen es nicht. Aber wir haben definitiv falsche Erwartungen, sonst wären wir alle zufriedener.
Männer wie Frauen haben sich in den letzten Jahren in eine Falle manövriert. Immerhin haben sich die Frauen daraus ein wenig freigestrampelt, indem sie mit dem Appell, was angeblich ein moderner Vater auch für die Familie zu leisten hat, ihren Männern das schier Unmögliche abpressen. Und die Männer tun das, was alle in Bedrängnis Geratenen tun: Sie kämpfen oder sie flüchten.
Den Kampf gegen die Widrigkeiten ihrer Existenz führen Männer an allen Fronten gleichzeitig. Da muss man sich vor den Kollegen rechtfertigen, weil man um 18 Uhr nach Hause will, oder man hört sich vom Vorgesetzten an, dass man sich das mit der Elternzeit doch bitteschön noch mal ganz genau überlegen sollte. Bei der Familie ist man nie oft und nie lange genug. Und die Frau bringt das rechte Verständnis für den Beruf nicht auf – wie auch? Schließlich war sie ja nie so richtig berufstätig, schon gar nicht einer solchen Position und weiß nicht, was da eigentlich verlangt wird, und wie kaputt man ist, wenn man am Abend oder am Wochenende nach Hause kommt und nur noch eines will: seine Ruhe.
Die Flucht jedoch ist meist eine Flucht raus aus der Familie und hinein in noch mehr Arbeit. Bei Jochen und Rainer, einem mit ihm befreundeten Unternehmensberater, beläuft sie sich auf 60 bis 80 Wochenstunden. „Ich bin mehr ein Mann für die Wochentage“, heißt das dann bei Rainer, wenn man ihn fragt, wie Weihnachten war. Und das obwohl auch er seine Familie über den Job stellt und das vollkommen ernst meint.
Während die Frauen bei ihrem Lebensentwurf gewinnen – materielle Sicherheit, Erfüllung des Wunsches nach Familie und Kindern, vom Mann finanzierte Aus- und Fortbildungen –, verlieren die Männer nichts Geringeres als ihre Männlichkeit. Alles was sie ausmachte, im Schlechten wie im Guten: also ihre Autonomie, ihr Machtstreben, ihr Verantwortungsbewusstsein, ihre Standhaftigkeit, ihr Selbstbewusstsein – all dies bleibt jetzt auf der Strecke. Und nicht etwa, weil Männer Elternzeit nehmen, Windeln wechseln und mit den Kleinen auf den Spielplatz gehen, sondern weil sie sich einem unmöglichen Lebenskonzept unterworfen haben. Wir haben unsere eigene Überforderung einfach an sie abgegeben, ohne einer Lösung des Problems wirklich näherzukommen. Die Männer haben sich unseren aberwitzigen Forderungen gebeugt und haben uns nichts entgegenzusetzen außer vielleicht die heim - lichen kleinen Fluchten in die Männerbündelei, in Affären oder in die Karriere.
Es ist ja nicht so, dass es mir – der Kinderlosen, Unverheirateten – an Verständnis für die Frauen mangelt. Ein Familienleben, das diesen Namen verdient, macht viel Arbeit, und Kinder verlangen eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit als ein Schriftsatz oder ein Softwareproblem. Männer, die sich vier Tage am Stück nonstop um die lieben Kleinen und den Haushalt inklusive Einkaufen, Kochen, Waschen und Putzen gekümmert haben, sind danach meist ein Fall fürs Sanatorium. Und wenn sie sich fragen, wie ihre Frauen das tagein tagaus eigentlich bewältigen, kommen sie zu dem Schluss, dass denen diese Art der Arbeit vielleicht einfach „mehr liegt“.
Was natürlich Quatsch ist, denn jeder Mensch, egal ob Mann oder Frau, verrichtet lieber eine Arbeit, die ein sichtbares Ergebnis und Unabhängigkeit mit sich bringt. Das kann man von Hausarbeit und Kinderbetreuung weiß Gott nicht behaupten.
Man sollte also nicht allen Ernstes erwarten, dass heutige Frauen in dieser ausschließ - lichen Tätigkeit ihr „Glück“ finden, wie es unseren Müttern mangels Alternativen und aus einem tradierten Rollenverständnis heraus vielleicht wirklich noch gelingen konnte. Zumindest konnten sie es sich einreden. Eine Lösung dieser verfahrenen Situation besteht ganz bestimmt nicht darin, den Männern einen Teil der Haus- und Erziehungsarbeit aufzuhalsen, ohne dass wir zu irgendeiner Form der Gegenleistung bereit wären.
Frauen, die in Deutschland Kinder haben und arbeiten, brachten es kürzlich sogar zu einem großen Artikel in der New York Times („In Germany Tradition Falls and Women Go to Work“). Das Phänomen der deutschen Frau, die einer geregelten Arbeit nachgeht, scheint aus einer anderen Perspektive betrachtet überaus selten und damit exotisch und bestaunenswert. Im Vergleich mit den Frauen in Amerika und nahezu allen europäischen Ländern sollten wir deutschen Frauen uns tatsächlich fragen, warum wir nicht auch hierzulande eine erwachsene Entscheidung treffen: Entweder Frauen tragen zum Familieneinkommen bei – und lösen dabei vielleicht nebenbei auch das ein oder andere Selbstverwirklichungsproblem – oder sie hören auf zu jammern und akzeptieren die Rolle der Hausfrau und Mutter.
„Meine Meinung ganz ehrlich? Quality time bedeutet für mich mittlerweile die Zeit im Büro. Daheim muss ich mir ständig Vorwürfe anhören, mache angeblich alles falsch und bin – wenn du meine Frau fragst – sowieso nie da und schon gar nicht, wenn es drauf ankommt. Meine Arbeit ist anstrengend, aber wenigstens habe ich da die Dinge unter Kontrolle“, gibt Rainer zu. Die meisten Männer sind allerdings weit davon entfernt, das sich oder anderen einzugestehen. Es ist ein gewaltiges Tabu, dass Männer womöglich lieber Zeit in einem Büro, in einer Werkstatt oder vor einem Computer verbringen als bei ihren Familien.
Dabei wissen wir doch insgeheim ganz genau, dass das größere Glücksempfinden dadurch entsteht, dass man etwas bewegt und Anerkennung für seine Leistung bekommt. Und das gelingt im Job meist besser, unmittelbarer und nachhaltiger als an der Heimatfront.
Jochens Arbeit ist zwar hart, aber dort fühlt er sich zu Hause. Nicht zu Hause hingegen fühlt er sich – zu Hause. Dieses Schicksal teilt Jochen mittlerweile nicht nur mit seinem Freund Rainer, sondern mit Tausenden von Vätern in Deutschland, „die sich neu erfinden sollen und wollen, am Ende aber doch ernüchtert sind“, wie Andreas Petzold unlängst im stern schrieb. Der Alltag im trauten Heim ist für moderne Männer anstrengender als ein Tag im Büro und zudem voller Unwägbarkeiten. Nur eine davon ist der Legostein, den Jochen neulich in seiner Fußsohle stecken hatte.
Ja, wir Frauen arbeiten uns seit Jahrzehnten an den Männern ab und zu Recht kritisieren wir den Männlichkeitswahn. Noch schlimmer ist es aber, wenn der Weiblichkeitswahn weiterhin in voller Blüte steht.
Anton ist die EMMA-Autorin, die die heftigsten Debatten provoziert. Eine neue ist hiermit eröffnet.