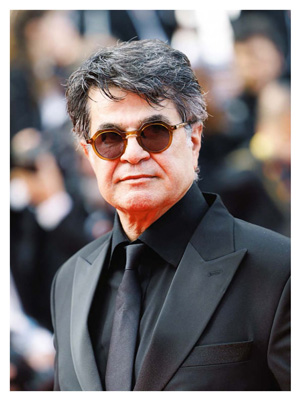Deutschland Privat
Der Ossi, der Wessi, der Wossi, der Bossi. Die weibliche Form für diese Spezies ist noch immer nicht erfunden, dafür aber gibt es darüber Witze zuhauf: lustige, böse, abgeschmackte, nette. Über die bösen wird am meisten gelacht. Das verbindet.
Inzwischen haben viele den kürzesten Weg, sich mißzuverstehen, gewählt: eine Ost-West-Liebesbeziehung. „Das Schönste ist“, erzählte mir vor Jahren eine Schulfreundin, die einen Kubaner liebte, „daß ich ihn nicht verstehe. Deshalb klingt alles, was er sagt, wie ein Kompliment.“ Diese wundervolle Erfahrung machen die liebenden Deutschen aus Ost und West nicht. Sie sind der Sprache des anderen mächtig. Der Affront geht sofort ins Herz.
Die Liebe zu einem Ausländer – und als solche betrachten viele Ostdeutsche ihre Landsleute aus dem Westen – war in der DDR eher eine Ausnahme. Sie war nicht gern gesehen (soweit ging die Solidarität denn doch nicht) und wurde stark problematisiert. Die Journalistin Jutta Resch-Treuwerth, in der DDR mit ihrer Rubrik „Unter vier Augen“ bekannt als Frau fürs Zwischenmenschliche, antwortete Ende der 70er Jahre in der „Jungen Welt“ auf die Frage eines Mädchens, ob es klug sei, einen Algerier zu heiraten: „Ihr habt euch in der DDR kennengelernt, es galten in euren Beziehungen die bei uns gültigen Maßstäbe, Sitten und Gebräuche. Auch er hat sich den Bedingungen des Gastlandes angepaßt. Was aber weißt du über das Zusammenleben von Menschen im Heimatland deines Freundes, wie sie arbeiten, essen, feiern, lieben? ... Unsere Haltung zur Freundschaft, zur Solidarität sollte wirklich nicht nur im großen wirksam werden, sondern sich auch in konkreten zwischenmenschlichen Beziehungen widerspiegeln. Darüber mußt du mit deinen Eltern diskutieren, aber eine Eheschließung sollte nicht dazu mißbraucht werden, das letzte Wort zu sprechen. Sie ist auch nicht geeignet, diese falschen Auffassungen, dieVoreingenommenheit zu korrigieren.“
So groß scheinen die Probleme mit der Ost-West-Liebe denn doch nicht zu sein, zumal ihr staatlicherseits nichts mehr im Wege steht. Mental scheint es jedoch nicht besonders zu klappen. Karin, Ostberlinerin, und Martin, Westberliner, wohnen gemeinsam im Ostteil der Stadt. Beim Einkaufen im Supermarkt, den Karin immer noch „Kaufhalle“ nennt, fragt er interessiert: „Was habt ihr eigentlich früher gegessen?“ Karin läßt ihn mit dem vollen Einkaufswagen stehen und entschwindet mitsamt dem Portemonnaie. Später meint sie: „Im Prinzip ist er noch gut weggekommen für diese blöde Frage.“
Sicher hätte jeder nach den bis zum Überdruß übertragenen Bildern des Herbstes 1989 erkennen können, daß Unterernährung wohl nicht das Problem war, an dem die DDR gescheitert ist. Und sicher war Martins Frage nicht der Versuch, die subtile Diskriminierung durch die plumpe Form zu ersetzen. „Es war“, sagt der Psychologe Martin, „etwas, von dem ich einfach nichts wußte. Deshalb habe ich gefragt.“ Und deshalb wurde er stehengelassen. Karin meint: „Wenn er interessiert gewesen wäre, hätte er es wissen können. Obwohl mir erst heute richtig klar ist, daß das, was die meisten Westdeutschen über uns wissen, nicht mehr als das Schwarze unter den Fingernägeln ist.“
Noch kaum je war Fragen so kompliziert, und noch kaum je ist mit einer Frage soviel in Frage gestellt worden wie seit der deutsch-deutschen Vereinigung. Ganz oben in der Hitliste der Fragen an Männer und Frauen aus dem Osten stehen: Warum habt ihr eigentlich so viele Kinder gemacht? Mußte jeder im Alter von 18 Jahren in die Partei? Wieviel hat ein Informant der Staatssicherheit verdient? Habt ihr wirklich nur geheiratet, um eine Wohnung zu bekommen? Gab es bei euch Deodorant?
Essen und Trinken, jetzt plötzlich ein gesamtdeutsches Vergnügen, war nicht selten der Indikator für all das, was uns fremd schien am anderen. Noch immer stehen in den Regalen der Ostberliner Supermärkte mehr billige Weine als anderswo. Und noch immer ist der häufigste Vortrag in den Beizen die westdeutsche Lesart vom passenden Wein zum richtigen Essen. Abgepackte Wurst gilt nicht als praktisch, sondern auch in linken Wohngemeinschaften als Verbrechen. Die härtesten Westmänner bekommen feuchte Augen, wenn sie ihre Kochkünste beschreiben und der barmherzigen Lüge ihrer Familien aufsitzen, man bekäme sie nur ins Restaurant, wenn Vater mal nicht kochen könne. Die Linken halten sich für die besten Gourmets, am Herd hören die sozialen Brennpunkte auf zu brennen. Es gibt eigentlich nur ein Gericht, mit dem die ostdeutsche Frau den westdeutschen Mann nachhaltig beeindrucken kann: die russische Soljanka, das Standardmenü in allen DDR-Kantinen. Für all die kleinen Demütigungen, welche die ostdeutsche Frau ertragen mußte, wenn ihr wieder mal der Unterschied zwischen Tagliatelle und Tortellini erklärt wurde, kann sie sich mit der Frage rächen: „Was, du weißt nicht, was Soljanka ist?“
Wir wissen inzwischen, daß die Wiedervereinigung statistisch betrachtet nur in der Politik und auf Staatsebene stattgefunden hat. In den zwischenmenschlichen Beziehungen bleiben die Ostdeutschen und die Westdeutschen mehrheitlich lieber unter sich. Wer aus dem Osten in den Westen geht, um dort sein Geld zu verdienen, hat meist eine Familie; wer aus dem Westen in den Osten geht, um treuhänderisch zu wirken, hat oft eine Aversion. Die Familie ist der Beweis, daß man geliebt, gebraucht und erwartet wird. Die Aversion wird durch die Vorurteile laufend bestätigt.
„Nachdem die Mauer, das erotische Bollwerk, gefallen war, veränderte sich alles in den deutsch-deutschen Beziehungen. Jahrelang gewachsene Freundschaften zerbrachen, die Verwandten verloren ihren Reiz und die Liebschaften ihr Fundament“, schrieb die ostdeutsche Zeitschrift für Mode und Kultur „Sibylle“ Ende letzten Jahres. Soviel geküßt wie am 9. November 1989, dem Tag der Maueröffnung, wurde in Ost und West tatsächlich nie wieder. Dieser Tag war frei von Mißverständnissen. Wer entsetzt war, ahnte, was ihn erwartete, wer sich freute, wußte, was er sich wünschte. Nie wieder aber würde ein herzerweichender Film gedreht werden über zwei Königskinder, die sich trotz Mauer und Stacheldraht lieben bis zum bitteren Ende. Und nie wieder konnten Pakete für die Ostverwandten von der Steuer abgesetzt werden. Ein Prüfstein für die Liebe.
Sehr bald schon begann via „Bild“-Zeitung und schnell zusammengeschusterte Umfragen die Meinungsbildung über die Libido der neuen deutschen BundesbürgerInnen. Nachdem festgestellt worden war, daß ostdeutsche Frauen eine viel höhere Orgasmusrate als ihre Geschlechtsgenossinnen im Westen aufzuweisen haben, fand „Bild“ die Erklärung für das Phänomen: „Überall dort, wo den Menschen nichts oder wenig geboten wird – außer viel Arbeit und wenig Lohn –, überall dort, wo es wenig Discos, Restaurants, Freizeitzentren, also wenig Vergnügungsmöglichkeiten gibt – überall dort wird intensiver Sex betrieben. Die DDR Erich Honeckers war so ein Land – viel Arbeit, wenig Abwechslung. Wo die Kneipen früh geschlossen und – technisch auf dem Stand von 1960 – nur zwei Fernsehprogramme ausgestrahlt wurden, gingen viele Menschen eher ins Bett.“
Inzwischen ist man über das Stadium der Beschreibung physischer und psychischer Eigenheiten der DDR-Eingeborenen hinaus. Das Interesse ist erlahmt. Weniger Leute als erwartet haben ihre persönlichen Erfahrungen mit Ost-West-Beziehungen gemacht.
Manche kamen aber doch, vor allem Männer. Nach fünf Jahren deutscher Einheit ist klar, daß die häufigste Ost-West-Beziehung zwischen Ostfrauen und Westmännern stattfindet. „Was macht diese Männer reizvoll?“ fragte „Sibylle“. „Sie sind erfahren, sie haben ihre Strategie im Umgang mit den Verhältnissen gefunden – sei es als Hans Dampf in allen Gassen, im Establishment oder in der Opposition – und können die Frauen ‘väterlich’ beraten.“ Westfrauen hingegen fänden Ostmänner eher unattraktiv, ohne Ausstrahlung, grau und noch schlechter gekleidet als Westmänner. Dem ist zuzustimmen. Sie sind schlechter gekleidet. Die Kleidung ist für den Ostmann nicht mit der Zurschaustellung eines Status verbunden. Kleidung als Synonym für das Portemonnaie einzusetzen, muß erst gelernt werden. Deshalb käme auch kein Ostmann auf die Idee, sein Weib diskret darauf hinzuweisen, daß schwarze Stretch-Jeans prolo sind, die Stiefel offensichtlich nicht aus echtem Leder, daß das Rouge ein wenig zu nuttig, die Bluse ein bißchen zu tantig aussieht.
Als Hannah von ihrem Freund, einem Grafiker, zum erstenmal in ein Spielcasino mitgenommen wird, zeigt sie am Eingang wie vorgeschrieben ihren Personalausweis. Den Nachfragen des Casino-Angestellten kann sie entnehmen, daß DDR-Personalausweise keine Empfehlung sind. Eher scheinen sie für kein Geld, keinen vernünftigen Beruf zu stehen. Hannah wird hochnotpeinlich überprüft, was in ihr den Wunsch weckt, den Casino-Angestellten öffentlich hinzurichten. Ihr Freund steht eher amüsiert daneben. Hannah schweigt an diesem Abend ausführlich. „Du hättest dich selber wehren können, als dir der Typ blöd kam“, sagt der Freund später.
Die kleinen Wunden sind schnell geschlagen. Bis zum Überdruß wurde deshalb von den Ostdeutschen der Begriff „Menschen zweiter Klasse“ bemüht. Auch von Frauen. Trotzdem ist die intellektuelle, erfahrene Frau aus dem Osten eine begehrte Geliebte.
Susanne ist 35 Jahre alt, berufstätig und Mutter von zwei Kindern. „Wir sind“, sagt sie, „ein irrer Schlag Weiber. Wir hatten diese Scheinemanzipation und haben scheinbar Karriere gemacht. Die Folge davon ist ein großes Selbstbewußtsein, das es uns ermöglicht hat, die blöden Heinis hinter uns zu lassen. Ich bin aggressionslos, habe keine Besitzansprüche, ich will nicht geheiratet werden, denn das Familienmodell habe ich bereits gelebt, ich brauche keinen Mann als Statussymbol. Und ähnlich wie der Westmann bin ich jetzt mehr auf mich fixiert. Meine Außenbeziehungen müssen sich dem zuordnen.“
Susanne lebt seit zwei Jahren von ihrem Mann getrennt. Eigentlich, schätzt sie, ist ihre finanzielle Situation nicht so, daß sie auf das Versorgungsangebot eines Mannes gut verzichten könnte. Ein solches Angebot ist denn auch aus Leipzig gekommen: „Er hat gesagt, ich könne in sein neugebautes Haus ziehen. Ich habe mir den Bauplan angesehen: Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer. ‘Und wo ist mein Zimmer?’ habe ich ihn gefragt. Darauf lasse ich mich nicht ein. Das Ost-Ehemodell liegt mir nicht mehr.“
Die Beziehung ohne feste Bindung scheint das ideale Konzept einer gut funktionierenden Ost-West-Liebe zu sein. Die Frau aus dem Osten kann sich selbst versorgen, ist in den meisten Fällen materiell unabhängig und deshalb für Westmänner wenig angstbesetzt. Widersprüche treten erst dann zutage, wenn sie ihre Ansprüche auf Geborgenheit (nicht Versorgung) einlösen möchte. „Geborgenheit ist nur punktuell zu haben“, sagt Lisa. „Es ist nicht die Geborgenheit, nach Hause zu kommen und jemanden vorzufinden, der einen auffängt, wenn es Probleme gab. Ich will nicht allein sein. Im Reden über unsere Ansprüche an eine Beziehung haben wir uns oft verletzt. Ich habe manchmal nicht gemerkt, wenn er seine Ruhe brauchte, seinen Freiraum, sondern habe jedesmal gedacht: Jetzt will er mich nicht mehr. Für mich war es ganz normal, daß Karsten meine Familie kennenlernt, weil ich ihr den Mann zeigen wollte, den ich liebe. Ich kenne seine Familie bis heute nicht. Es war auch nicht möglich, daß er sich auf mein Leben mit den zwei Kindern einließ. Ich spielte immer die Vermittlerrolle zwischen Kindern und Mann. Und irgendwann stimmte der Energiehaushalt nicht mehr. In der Beziehung herrschte nicht mehr Gleichberechtigung, krankhafte Abhängigkeiten entstanden. Warten auf einen Anruf, kein Wochenende mehr planen, weil man immer denkt, es kommt noch ein Angebot von ihm. Teilweise war ich nicht mehr ich selbst.“
Kulturelle und gesellschaftliche Unterschiede, meint die arbeitslose Frau aus dem Osten, sind nicht mehr das Problem. „Wir hatten Zeit, um voneinander zu lernen. Und ich habe gelernt, daß der Traum vom Idealprinzen, der kommt und mich ganz macht, nicht funktioniert. Das muß ich selber machen.“
An einem, so scheint die Realität zu beweisen, leiden ostdeutsche Frauen in ihren grenzüberschreitenden Beziehungen nicht: an der Überfürsorglichkeit ihrer Partner. Sie wissen aber diesen Umstand meist zu schätzen, denn viele haben den überfürsorglichen Mann in der DDR kennengelernt. „Ich bin eine starke Frau. Ein Mann, der für mich sorgt, ist einer zuviel“, sagt Karin, die 40jährige Politikerin. Vor einigen Wochen borgte sie sich das Auto ihres Freundes, um zur Arbeit zu fahren. Beim Frühstück hielt er ihr einen Vortrag über die Besonderheiten des Autos, erklärte ihr die Kupplung, warnte sie vor den Straßenverhältnissen. Am Abend kam Karin mit dem Auto zurück. Sämtliche Scheiben war eingeschlagen worden. Martin, der Psychologe, war fassungslos. „Dabei wird die Kiste doch nur noch vom Dreck zusammengehalten“, meinte Karin. Die Situation eskalierte, und plötzlich war alles in Frage gestellt: die Arbeitsteilung, die Haushaltsführung, die Freizeitgestaltung, der Umgang miteinander... Am Ende der Debatte knallte Karin 1.000 Mark für die Reparatur auf den Tisch und schlug vor, ab sofort in einer Wohngemeinschaft zu leben. „Er kann nicht begreifen, daß ich beschäftigt genug bin, um Probleme zu klären wie ein Mann. Wenn das Auto kaputt ist, bekommt er Geld, um es reparieren zu lassen“, sagt Karin.
Obwohl die Frauen aus der DDR oft als die „Verliererinnen der deutschen Einheit“ bezeichnet werden, haben sie in mancher Hinsicht bessere Mechanismen als die Männer entwickelt, um den Einheitsschock zu bewältigen. Nicht im selben Maße wie die Männer mit Prestigeverlust konfrontiert – so hoch hinaus konnten Frauen auch in der DDR nicht kommen –, sind sie oft schneller der Phase des Entsetzens entronnen als die Männer. Viele tauschten mit ihrem plötzlich arbeitslosen Partner die Rolle. Und viele waren viel schneller in der Lage, sich mit der Unabänderlichkeit der neuen Situation abzufinden. Karin: „Weil ich natürlich weiß, daß nichts von Dauer ist. Ich habe verstanden, daß jedes System Gefahr läuft, sich zu verspielen. Im Wissen darum kann ich mich gelassen zurücklehnen.“
Hannah sagt: „Ich bin losgeschwommen, als mir klar war, daß nichts mehr zu ändern ist. Jetzt, über die Mitte des Flusses hinausgekommen, kann ich nicht mehr darüber nachdenken, ob das heimische Ufer doch schöner war als das neue.“
Geteilt wird nicht mehr soviel, seit alles zusammengewachsen ist. Zu sehr gehen noch Lebensplanung und Lebenskonzepte auseinander. Mehr auf sich selbst gestellt, waren westdeutsche Frauen und Männer viel mehr gezwungen, persönliche Vorsorge zu treffen. Als ich Lisa frage, was sie an ihrem westdeutschen Partner am meisten erstaunt habe, antwortet sie: „Als er mir sagte, er sei sterilisiert, habe ich mich gefragt, ob man das entscheiden kann, noch bevor man die Frau seiner Träume kennengelernt hat. Bevor man weiß, ob sie vielleicht gern ein Kind haben möchte.“
Nur für sich selbst eine Entscheidung zu treffen, mußten viele Frauen lernen. Und trotzdem, da die Männer, die ihnen aus dem fremden Westen begegnen, nur zu oft schon das fertige Konzept haben, passen sie sich häufig an. „Noch vor vier Jahren“, sagt die 33jährige Journalistin Hannah, „hätte ich jeden für verrückt erklärt, der mir die Vorteile einer offenen Dreierbeziehung hätte ans Herz legen wollen. Jetzt lebe ich so – zwei Frauen, ein Mann. Aber nicht, weil ich es wollte. Ich finde, die Art, sich und seine Gefühle zu teilen, muß erlernt werden. Und ich streite nicht mehr ab, daß es auch Gewinne dabei gibt. Alles, was ich jedoch für mich ziemlich genau definieren kann, ist der Verlust, den ich dadurch erleide. Die Wahrscheinlichkeit, daß ich allein sein werde, wenn ich alt bin, ist ziemlich groß. Die Wahrscheinlichkeit, daß das bitter wird, noch größer. Es gibt nur noch wenig Möglichkeiten, emotionale Altersvorsorge zu treffen.“
Ole, der junge dynamische Ostdeutsche, hat ein Jahr mit einer Westfrau zusammengelebt. Als knapp über 20jähriger ist er offen und noch wenig beziehungsgeschädigt oder -geprägt. Zwischen Leuten aus dem Osten und dem Westen stellt er Unterschiede fest. „Man ist mit einer ganz anderen Kultur aufgewachsen. Einen Film zusammen zu sehen, ein Buch zu lesen – alles muß ganz anders erklärt werden. Es gibt nicht das stille Einverständnis, das auf der Basis gleicher Erlebnisse entsteht. Und dann gibt es riesige Unterschiede im Sexuellen. Westfrauen, finde ich, reden gerne und viel über Sex, sie zerreden’s. Ostfrauen tun’s einfach gern. Ich glaube, das liegt daran, daß Westfrauen überhaupt viel therapeutischer sind. Aber das liegt wohl am System.“
Das System färbt ab, bei allen Widerständen. In persönlichen Beziehungen lernt es sich am schnellsten. Verhaltensnormen werden übernommen, die Sprache ändert sich. Auch die Ostdeutschen „hinterfragen“ jetzt häufiger als zu fragen. Sie „führen Diskurse“ und reden weniger miteinander, sie können inzwischen „damit umgehen“, bevor sie wissen, ob es gut für sie ist. Und natürlich lächeln sie jetzt über Fragen, bei denen sie am Anfang noch aus Rock und Hose gesprungen sind. „Was habt ihr früher gegessen?“ wird heute meist nur mit einem müden „trockenes Brot und Waser“ quittiert.
In gewisser Weise hat die mit soviel Reden bedachte Mauer in den Köpfen verhindert, daß die persönliche Enttäuschung zum gesamtgesellschaftlichen Phänomen wurde. Da es weder eine wirtschaftliche noch eine soziale Einheit gibt, besteht auch in absehbarer Zeit nicht die Gefahr massenhafter Ost-West-Rosenkriege. Und noch längere Zeit wird der Westmann angestrengter suchen müssen, wenn er eine ostdeutsche Frau an seinen Herd stellen will.
Charlotte ließ sich 1990 im Alter von 65 Jahren scheiden. Im vergangenen Jahr lernte sie in der Berliner U-Bahn einen Mann „vom Ku’damm“ kennen. „Der hat mich zum Essen eingeladen und allen Ernstes erwartet, ich würde bei ihm kochen. Da habe ich gesagt: ‘Also zum Kochen bin ich nicht gekommen. Du wirst mit mir schon in eine Gaststätte gehen müssen.’ Der hat sich wahrscheinlich gedacht, er findet eine, die ihm jetzt den Haushalt führt. Aber nicht mit mir. Trägt das Hemd bis zum Bauch offen, nur damit ich seine Goldkettchen sehe, und geht zum Sonntagsvergnügen mit mir auf den Trödelmarkt. Da hat er eine häßliche Lampe gekauft, die er mir schenken wollte. ‘Was soll ich mit der Lampe?’ habe ich ihn gefragt. ‘Die gefällt mir nicht.’
„Früher, als die Mauer noch stand, waren die Intershops die einzigen Läden im Ostteil der Stadt, in denen es nach Lux und Jacobs roch, nach Freiheit und Wohlstand. Wenn Verwandte oder FreundInnen aus dem Westen kamen, dann umhüllte sie ebenfalls eine Aura, die nach großer weiter Welt duftete“, beschrieb „Sibylle“ die Erotik des Fremden. Dann kam die Vereinigung. „Wir haben den Akt, dessen Folgen ungewiß sind, gemeinsam vollzogen, nach langen Jahren frustreicher Sicherheitspartnerschaft. Inzwischen ist die kurze Hoch-Zeit orgiastischer Vereinigungsfeten vorüber“, resümiert der ostdeutsche Psychologe Konrad Weller in seinem Buch „Das Sexuelle in der deutsch-deutschen Vereinigung“.
Lisa hat sich von ihrem Freund getrennt. Sie sagt: „Über manches kann ich erst jetzt richtig nachdenken. Darüber, welche Ansprüche ich an Beziehungen habe und warum unsere schiefgegangen ist. Ohne ihn wäre alles noch viel schwieriger gewesen. Mit ihm war es nicht leicht.“
Karin glaubt, inzwischen mitleidfähiger zu sein. „Vor allem durch die Arbeit mit Westmännern habe ich gesehen, wie viele von denen arme Schweine sind. Sie arbeiten bis zum Umfallen; Geld, Status und alles um den Preis, daß die Erotik flötengeht.“
Ole ist Vater geworden und lebt mit seiner ostdeutschen Freundin zusammen, mit der er sich das Erziehungsjahr teilt. Hannah glaubt, fast im Westen angekommen zu sein, und läßt manchmal das Küchenlicht brennen, um sich die Illusion zu verschaffen, es warte jemand zu Hause auf sie. Susanne meint, die Phase intensiver Beziehungen trotz Bindungslosigkeit sei eine der wichtigsten in ihrem Leben. Und schön. Charlotte ist immer noch allein.