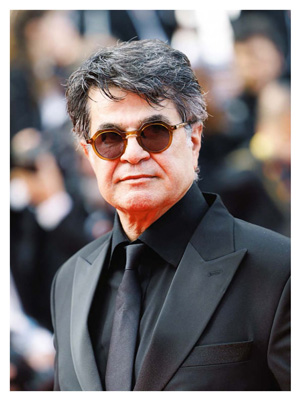Es fängt sehr früh an
Zufällig ist an der staatlichen Universität in Bloomington/Indiana das Kinsey-Institut angesiedelt, ein von dem Biologen Alfred Kinsey gegründetes Zentrum zur Erforschung der Sexualität. Ich flog an einem eisigen Winternachmittag dorthin, um mich mit Debby Herbenick, einer Professorin an der School of Public Health, zu treffen. Herbenick hatte mich eingeladen, an ihrem Kurs zum Thema „Menschliche Sexualität“ teilzunehmen, einer der beliebtesten Veranstaltungen an dieser Universität.
An dem Tag gab sie eine Vorlesung zu den geschlechtsspezifischen Unterschieden in Bezug auf sexuelle Befriedigung. Als wir eintrafen, saßen schon mehr als 150 StudentInnen im Hörsaal, fast alle weiblich, die meisten in Sweatshirts, die Haare zum Pferdeschwanz zusammengebunden.
Sie hörten aufmerksam zu, als Herbenick die unterschiedliche Sprache erläuterte, die junge Männer und junge Frauen verwenden, wenn sie über „guten Sex“ sprechen. „Männer sprechen eher über Lust, über Orgasmen“, sagte Herbenick, „Frauen eher über Schmerzfreiheit. 30 Prozent der Collegestudentinnen geben an, beim Sex Schmerzen zu haben, was nur bei fünf Prozent der männlichen Studenten zutrifft.“
Die Zahl der Frauen, die über Schmerzen beim Sex klagen, fügte sie hinzu, steigt rasant auf 70 Prozent an, wenn es um Analsex geht. Bis vor kurzem war Analsex bei jungen Erwachsenen eine relativ seltene Sexualpraktik. Da er aber in Pornos überdurchschnittlich häufig gezeigt wird, findet er auch im echten Leben zunehmend Verbreitung. Noch 1992 gaben in den USA nur 16 Prozent der Frauen zwischen 18 und 24 Jahren an, Analsex ausprobiert zu haben. Heute haben 20 Prozent der Frauen zwischen 18 und 19 und bis zu 40 Prozent der Frauen zwischen 20 und 24 schon mal Analsex gehabt.
Eine Studie aus dem Jahr 2014 unter heterosexuellen Jugendlichen zwischen 16 und 18 ergab, dass in erster Linie Jungs darauf drängten. Sie sahen darin weniger einen Ausdruck von besonderer Intimität mit ihrer Partnerin (bei der sie davon ausgingen, dass sie dazu genötigt werden müsse und könne), sondern einen Wettbewerb mit anderen Jungs.
Von Mädchen wurde erwartet, dass sie es über sich ergehen ließen, und diese gaben auch durchweg an, dass es schmerzhaft gewesen sei. Beide Geschlechter machten die Mädchen dafür verantwortlich – sie seien „naiv oder defekt“, unfähig, sich zu „entspannen“.
Deborah Tolman bezeichnete Analsex schlicht als „den neuen Oralsex“. „Da inzwischen von allen Mädchen erwartet wird, Oralsex im Repertoire zu haben“, sagte sie, „wird Analsex zur neuen ‚Tut sie es oder tut sie es nicht?‘-Frage, zum neuen ‚Liebesbeweis‘.“ Und immer noch, fügte sie hinzu, „ist die sexuelle Lust der Mädchen nicht Teil der Gleichung.“
Laut Herbenick werden junge Mädchen durch die zunehmende Verbreitung von Analsex erneut unter Druck gesetzt, eine Leistung zu erbringen, wenn sie nicht als prüde abgestempelt werden wollen. „Es ist eine Metapher für die Normalisierung weiblichen Schmerzes. Wenn man es nicht tun will, ist man nicht gut genug, man ist frigide, man verpasst etwas, erforscht nicht seine Sexualität, hat keinen Abenteuergeist.“
Ich erinnerte mich an ein Gespräch mit Lily, dem Mädchen, das sich über das ständige Interesse seines Highschool-Freundes am Geschlechtsverkehr geärgert hatte. Sie hatte erzählt, dass er sich oft Pornos angeschaut hatte und besonders scharf darauf gewesen sei, Analsex auszuprobieren. Sie ließ sich darauf ein, weil sie ihn zufriedenstellen wollte. „Beim ersten Mal mussten wir direkt wieder aufhören, weil ich es so unangenehm fand“, sagte sie. „Später drängte er mich, es wieder zu tun. – Ich tat es wahrscheinlich aus Trotz, nach dem Motto: Okay, ich tu’s noch mal, aber es wird mir wieder nicht gefallen.“ Sie lachte. „Was eindeutig keine gesunde Einstellung ist.“
Mädchen lassen sich mit vier Mal höherer Bereitschaft als Jungs auf sexuelle Aktivitäten ein, die sie nicht wollen, insbesondere auf Oral- oder Analsex. Anscheinend gewöhnen sich die Mädchen bei sexuellen Aktivitäten eher an Zwang und Schmerzen als an Lust und Orgasmen. 75 Prozent aller Männer geben in jeder Altersgruppe an, beim Sex mit einer Partnerin regelmäßig zum Höhepunkt zu kommen – was nur bei 29 Prozent der Frauen der Fall ist.
Frauen benutzen laut Herbenick auch eine negativere Sprache als Männer, wenn sie über unbefriedigende sexuelle Erfahrungen sprechen. Sie sprechen von Schmerzen, aber auch darüber, sich erniedrigt und deprimiert zu fühlen. Kein einziger der befragten Männer brachte ähnliche Gefühle zum Ausdruck.
Sara McClelland hat den Begriff „Intimgerechtigkeit“ geprägt. Bei den von ihr befragten Collegestudenten neigten die Frauen dazu, die körperliche Befriedigung ihres Partners als Maßstab für ihre eigene Befriedigung zu nehmen. Sie sagten Dinge wie: „Wenn er befriedigt ist, bin ich es auch.“ Bei den Männern war das anders: Ihr Maßstab war der eigene Orgasmus. Wenn also junge Frauen eine gleich häufige oder häufigere „sexuelle Befriedigung“ als Männer angeben (was bei wissenschaftlichen Studien oft der Fall ist), kann sehr Unterschiedliches gemeint sein. Wenn ein Mädchen in der Hoffnung, dass es nicht weh tut, dass ein Gefühl der Nähe entsteht und dass ihr Partner zum Orgasmus kommt, eine sexuelle Begegnung hat, dann wird sie schon „befriedigt“ sein, wenn diese Hoffnungen erfüllt sind.
Wenn ich mir die Erzählungen der Mädchen in Bezug auf „körperlose“ frühe Erfahrungen anhöre, kommt mir der Verdacht, dass wir an unseren Töchtern eine Art „psychologischer Klitoridektomie“ (weibliche Beschneidung) vorgenommen haben. Was wäre, wenn die Mädchen Sexualität leben könnten mit der Kenntnis der eigenen körperlichen Reaktionen, statt als bloße sexuelle Dienstleistung? Was wäre, wenn sie durch Selbstkenntnis ermutigt werden würden, sowohl innerhalb als auch außerhalb von Beziehungen höhere Maßstäbe an ihre Erwartungen anzulegen?
Eine 18-jährige Highschool-Schülerin sagte: „Ich wusste schon, bevor ich das erste Mal Sex hatte, was es für einen Jungen bedeutet zu kommen. Man weiß, dass es passieren muss, damit der Sex vorbei ist und die Jungs sich gut fühlen. Aber ich hatte keine Ahnung, was es für ein Mädchen bedeutet. Ganz ehrlich? Ich weiß es immer noch nicht. Es kommt nie zur Sprache. So habe ich mich auf all das eingelassen, ohne mich selbst wirklich zu verstehen.“
Ein Gesundheitspädagoge wird mit den Worten zitiert: „‚Spuckst du oder schluckst du?‘, das ist unter Schülern der siebten Klasse eine normale Frage.“ Angeblich gehen Mädchen in der Freistunde oder im hinteren Teil des Schulbusses auf die Knie und erledigen schnell mal einen Blowjob.
Oralverkehr, das heißt Fellatio, ist unter Teenagern in den USA zu etwas relativ Alltäglichem geworden. Bis zum Ende der neunten Klasse hatte einer von fünf Jugendlichen Oralverkehr; bis zum Alter von 18 Jahren hatten zwei Drittel Oralverkehr.
Eine junge Frau namens Ruby war kurz nach ihrem Highschool-Abschluss bereit, in einem Vorort von Chicago mich mit ihr und vier ihrer Freundinnen darüber zu unterhalten. Wir trafen uns in Rubys Zimmer: eine Wand mitternachtsblau. Leggings, T-Shirts und Röcke quollen aus halboffenen Schubladen. Die Mädchen lümmelten sich auf dem Boden, auf dem Bett und einem Sitzsack.
Als ich sie nach Oralsex fragte, schüttelte ein Mädchen namens Devon den Kopf. „Das ist kein Ding mehr“, sagte sie und machte eine wegwerfende Handbewegung. – „Was ist es dann?“, fragte ich. – Devon zuckte die Schultern. „Es ist nichts.“ – „Na ja, nichts ist es nun auch wieder nicht“, meinte Rachel. – „Es ist kein Sex“, gab Devon zurück. – „Es ist wie ein Schritt über das Knutschen hinaus“, sagte Ruby. – „Es ist eine Möglichkeit, weiter zu gehen, ohne eine große Sache daraus zu machen.“ – „Und es hat nicht die Konsequenzen, die vaginaler Sex hat“, fügte Rachel hinzu. „Man verliert nicht seine Jungfräulichkeit, man kann nicht schwanger werden, man holt sich keine Geschlechtskrankheiten. Darum ist es sicherer.“ Der Hauptgrund der Mädchen für die orale Befriedigung der Jungen ist laut einer Studie unter Highschool-Schülern der Wunsch, die Beziehung zu verbessern.
Psychologen warnen seit Jahren davor, dass Mädchen schon früh lernen, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken, um Konflikte zu vermeiden und in Freundschaften und Liebesbeziehungen den Frieden zu wahren. Anscheinend ist die Zufriedenheit ihres Freundes das Hauptanliegen vieler Mädchen. Die Mehrheit der Jungen gab als Hauptgrund für Oralsex körperliche Befriedigung an.
Geschlechtsverkehr konnte zur Stigmatisierung als „Schlampe“ führen, während Oralsex, zumindest unter bestimmten Umständen, die richtige Art von Reputation mit sich bringt. „Oralsex ist wie Geld oder irgendeine Art von Währung“, erklärte Sam. „So freundet man sich mit den beliebten Jungs an. Und man sammelt Punkte für das Rummachen mit jemandem, ohne tatsächlich Sex zu haben. Dann kann man sagen: ‚Ich habe mit dem und dem rumgemacht‘, und kann dadurch seinen sozialen Status erhöhen. Ich glaube, es ist unpersönlicher als Sex, darum sagt man: ‚Es ist keine große Sache‘“.
Eines Tages traf ich mich im Golden Gate Park in San Francisco mit Anna, einem Erstsemester an einem kleinen College an der Westküste. Anna war in einer politisch liberalen Familie aufgewachsen und hatte bis zur zwölften Klasse progressive Privatschulen besucht. „Es hat damit zu tun, dass Mädchen sich schuldig fühlen“, sagte Anna. „Wenn man mit auf das Zimmer eines Jungen geht und mit ihm rummacht, tut es einem leid, wenn man am Ende geht, ohne ihn befriedigt zu haben. Aber eigentlich ist das unfair. Ihm tut es ja auch nicht leid, wenn das Mädchen unbefriedigt bleibt.“
In ihrer Studie zu Highschool-Schülerinnen und Oralsex fand April Burns, Professorin der Psychologie an der City University von New York heraus, dass Mädchen zu Fellatio ein ähnliches Verhältnis hatten wie zu Hausaufgaben: Es ist etwas, das erledigt werden muss, das man beherrschen muss und wofür man beurteilt wird. Wie bei den Schularbeiten befürchten die befragten Mädchen, beim Oralsex eine schlechte Leistung zu bringen und vom Jungen „schlechte Noten“ dafür zu bekommen.
Es befriedigt sie zwar, einen Blowjob gut zu erledigen, aber die Befriedigung, von der sie sprechen, ist nie körperlicher Art, nie in ihrem eigenen Körper angesiedelt. Die Mädchen sind in Bezug auf Oralsex in jeder Hinsicht leidenschaftslos, woraus die WissenschaftlerInnen schließen, dass sie sich aufgrund ihrer Sozialisation in ihren Beziehungen eher als „Lernende“ denn als „Begehrende“ sehen.
Das Anliegen des Befriedigen statt das Befriedigtsein war auch bei allen Mädchen, mit denen ich sprach, vorherrschend. Sie hatten oft das Gefühl, dass sie nie wieder würden Nein sagen können, wenn sie erst einmal zum Geschlechtsverkehr Ja gesagt hatten – ob sie nun in Stimmung waren oder nicht. „Ich weiß noch, dass ich es irgendwie gehasst habe“, meinte Lily, Studentin im zweiten Jahr an einer staatlichen Universität an der Westküste. „Ich wollte ihn befriedigen. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass wir keine normale Unterhaltung führen konnten, weil er ständig Sex mit mir haben wollte. Und mir fiel einfach kein Grund dafür ein, es abzulehnen.“
Die 17-jährige Gretchen sagte, sie genieße den (wenn auch kurzzeitigen) Kick, Macht über einen Jungen zu haben. „Ich habe jetzt vier Jungs einen geblasen. Ich weiß nicht mal, warum ich es tue.“ Sie hielt inne und kaute nachdenklich auf ihrer Unterlippe herum.
„Wahrscheinlich gefällt mir dieses Gefühl: ‚Ha! Ich habe hier die Kontrolle!‘. Man weiß, dass die Jungs es wirklich, wirklich wollen. Man kann erst ‚Nein, nein!‘ sagen, und sie dann ‚Bitte, bitte!‘ sagen lassen, weil sie es so dringend brauchen. Das macht irgendwie Spaß. Aber die körperliche Seite davon sicher nicht, weil es eklig ist und mir im Hals weh tut. Ich meine, es macht irgendwie Spaß, in den Rhythmus zu kommen, aber es macht nie richtig Spaß.“
Mädchen gelten als Wächter über das männliche Verlangen, die die Aufgabe haben, es unter Kontrolle zu halten und umzulenken. Inzwischen sind sie auch dafür verantwortlich, es zuverlässig zu befriedigen. Oralsex ist ihr Kompromiss, ein Schlupfloch, eine Strategie zur Erfüllung der Erwartung mit minimalem körperlichem, sozialem oder emotionalem Einsatz. „Es ist irgendwie fast … sauber. Wissen Sie, was ich meine?“, sagte eine Schülerin einer Highschool in New York. Ich wusste nicht, was sie meinte, nicht wirklich. „Es ist …, es ist …“, überlegte sie laut, „es ist das, was von einem erwartet wird.“