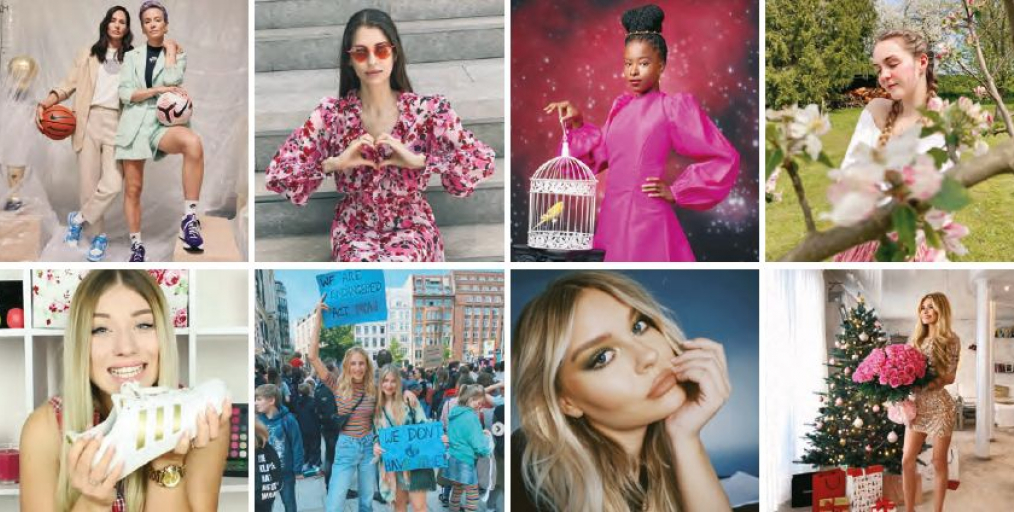Der neue „Halal-Feminismus“
„Seit wann werden Frauenwerte im Islam eingeschränkt? In der Zeit vor der Hinabsendung des Koran, waren Frauen nichts wert und wurden schändlich behandelt. Der Islam gab den Frauen endlich ihre Rechte.“ Das schreibt eine gewisse Hanna Hansen in einer E-Mail. Sie wisse nicht, wo in muslimischen Ländern die Rechte von Frauen beschnitten sein sollen, fährt sie fort. Vielmehr sei es doch der Westen, der Musliminnen und Muslime ihrer Freiheiten und Rechte beraube. Die 42-jährige gebürtige Deutsche gilt mit über 500.000 Followern als muslimischer Shooting-Star auf TikTok und Instagram. Vor ein paar Jahren konvertierte die ehemalige Boxerin zum Islam, seitdem missioniert sie und predigt ihre Liebe zu Allah.
Hanna Hansen ist Teil einer neuen muslimischen "Frauenbewegung", die auf TikTok und Instagram seit Jahren einen regelgerechten Boom erlebt. Junge streng gläubige muslimische Frauen übernehmen zunehmend eine wichtige Rolle in der konservativ bis fundamentalistischen islamischen Öffentlichkeitsarbeit, die zuvor ausschließlich männliche Prediger innehatten. Es ist eine Art digitaler Feldzug mit dem Smartphone, dem Koran und dem Hidschab. Die jungen Frauen vermitteln auf ihren Kanälen ein vermeintlich perfektes muslimisches Leben zwischen Koransuren und Schminktipps, Ramadan und Lippenstift. In Hochglanzvideos wird das Ideal der keuschen und verschleierten muslimischen Frau propagiert, das als Gegenentwurf zur „sündigen“ westlichen Frau verstanden werden soll.
Mit ihren Inhalten erreichen die islamistischen Influencerinnen Millionen Mädchen und Jungen und prägen damit das religiöse Bewusstsein einer jungen digitalen Generation. Ihre Videos sind perfekt inszeniert, oft im Stil von Netflix-Serien. Sie verstehen die Mechanismen von Social Media, wissen genau, was Jugendliche anspricht. Die Influencerinnen verkaufen den Islam als Pop, die religiöse Abgrenzung von der Mehrheitsgesellschaft als Identitätsfrage. Ihr rückwärtsgewandtes Weltbild hat dabei mit einer liberalen Gesellschaftsidee nur noch wenig zu tun. Ihre konservative bis fundamentalistische Auslegung des Korans verstehen sie als neue Normalität.
Die Videos der Influencerinnen sind perfekt inszeniert, oft im Stil von Netflix-Serien
Der Hidschab als sichtbares Zeichen des Islam spielt dabei eine zentrale Rolle und wird dabei nicht nur als religiöse Pflicht gesehen, sondern zu einem Akt der Selbstbestimmung umgedeutet. Das Kopftuch sollen Frauen „wie eine Krone tragen“, rät etwa die muslimische Influencerin Amal Kobeissi. Der Hidschab lasse die Frauen „erstrahlen wie Prinzessinnen“. Sie wolle sich durch die vielen Anfeindungen, weil sie ein Kopftuch trägt, „nicht klein machen lassen“, sie würde dadurch „nur stärker“, erklärt sie in einem Video. Die gebürtige Deutsche mit libanesischen Wurzeln präsentiert sich auf TikTok als strengkonservative Muslima, sie postet Videos aus ihrem familiären Alltag, gespickt mit religiösen und politischen Botschaften.
So fragt sie sich empört, warum der Iran keine Atombombe haben dürfe, die Zionisten aber schon. Auf Instagram folgen ihr über 220.000 Menschen, auf TikTok eine halbe Million. Kobeissi zählt mit dieser Reichweite zu den einflussreichsten muslimischen deutschsprachigen Influencerinnen. Um andere Frauen zu animieren, den Hijab zu tragen, hat sie praktischerweise gleich eine eigene Kopftuchmodelinie auf den Markt gebracht, die sie auf ihren Kanälen vermarktet. Ein Geschäft mit der Religion, offenbar kein Widerspruch.
So wie Kobeissi erzählen muslimische Influencerinnen in abertausenden Videos, warum sie sich verhüllen, wie die Gesellschaft damit umgeht, wie sie oft ausgegrenzt und angefeindet werden. Das Kopftuch zu tragen, wird zum Zeichen der Emanzipation erklärt. Ihre Botschaft: Frauen werden im Islam geachtet und können ihre Religion ohne Zwang frei ausleben. Dass auch in Europa oft das Gegenteil der Fall ist, und dass Frauen in den meisten muslimischen Ländern gezwungen werden, das Kopftuch zu tragen und bei Verstößen im Iran oder in Afghanistan im Gefängnis landen, gefoltert oder sogar hingerichtet werden, spielt im grellen TikTok-Glamour keine Rolle.
Gegen jedes angebliche politische Kopftuchverbot werden vielmehr wütende Gegenkampagnen gestartet. Unter den Hashtags #NeinzumKopftuchverbot, oder #KopftuchunserePflicht werden tausende Videos produziert und geteilt. Ein Verbot wird als diskriminierend und rassistisch und Angriff auf den Islam geframt.
Musliminnen, die sich gegen das Kopftuch entscheiden, werden angefeindet
Musliminnen, die sich öffentlich gegen das Kopftuch entscheiden, werden angefeindet und an den digitalen Pranger gestellt. „Ich wurde in hunderten Hassnachrichten als Hure beschimpft und mit dem Tod bedroht“, erzählt die junge türkische TikTokerin Zeinab, die lieber anonym bleiben möchte und ihr Kopftuch vor zwei Jahren abgelegt hat.
Salafisten-Prediger bauen in tausenden Videos eine regelrechte Drohkulisse gegen „abtrünnige“ Frauen auf. Sie werden als „geistig Verwirrte“ bezeichnet, die sich nicht wundern müssen, wenn sie zum „Freiwild“ erklärt werden. Muslimische Männer werden aufgefordert, diese Tendenzen im Keim zu ersticken und ihre kranken Frauen „behandeln“ zu lassen. „Auf junge Mädchen wirkt das alles sehr einschüchternd”, sagt Zeinab.
Auch Hanna Hansen sieht im Kopftuch einen „Befreiungsakt“, warnt davor, es abzulegen. Hansen verbreitet auf ihren Kanälen keinen wertekonservativen „Fashion-Islam“, sondern ein fundamentalistisches Islamverständnis, das nicht nur männliche, sondern auch immer mehr weibliche Anhängerinnen findet. Hansen steht exemplarisch für tausende Konvertitinnen und Konvertiten, die auf TikTok und Instagram ihren Glaubenswechsel öffentlich leben.
Wer aber ist Hansen? Sie wurde in Herford geboren und war jahrelang ein gefragtes Fashion-Model. Danach verdiente sie als DJ ihr Geld, bevor sie ins Boxgeschäft einstieg. Sie wurde Kickboxerin und sogar Weltmeisterin. Eine Verletzung stoppte ihre Karriere.
Die ehemalige Kick-Boxerin predigt nun, dass ihr Weg zu Allah der einzig richtige sei
Ihre Boxhandschuhe hat sie heute gegen den Hidschab und streng muslimische Kleidung getauscht. Statt im Ring zu kämpfen, sitzt die Mutter von zwei Kindern jetzt vor der TikTok-Kamera und predigt, wie sie durch den Islam endlich einen Sinn im Leben gefunden habe und dass der Weg zu Allah der einzig richtige gewesen sei.
Hansen kann als „Salafistin light“ bezeichnet werden, sie übernimmt quasi eins zu eins die radikale Agenda ihrer männlichen Glaubensbrüder. Inzwischen steht Hansen auch im Fokus des Staatsschutzes. Sie findet die Scharia gut, glaubt, dass Muslime im Westen geknechtet werden, spricht sich gegen Sex vor der Ehe aus und meint, dass Homosexualität eine „Sünde“ sei. Hansen ist überzeugt davon, dass der liberale und freizügige Westen mit seiner Säkularität am Ende und der Koran das letzte Update von Allah für die Menschheit sei. Sie hätte lange in dieser „Scheinwelt“ gelebt und wäre daran „fast zerbrochen“, sagt sie.
Sie spricht vor allem westliche Frauen an, die männliche Prediger kaum erreichen. Sie hält Predigten und Vorträge, organisiert Treffen mit Glaubensschwestern und postet am laufenden Band Videos von Frauen, die über ihre Kanäle online zum Islam konvertieren.
Hansen sammelt Spenden und reist nach Mekka und Medina, postet von dort Videos aus den Moscheen. Eine theologische Ausbildung kann die Influencerin nicht vorweisen. Laut BILD soll Hansen mit dem salafistischen Hassprediger Sven Lau verheiratet sein, als seine dritte Ehefrau. Hansen behauptet in einem Video, dass es keinen Ehemann gäbe, der sie gezwungen habe, den Islam anzunehmen: Es sei ihre freiwillige Entscheidung gewesen.
Hanna Hansens Kontakte ins salafistische Milieu sind offenkundig
Dass viele Frauen auf Druck ihrer muslimischen Männer zum Islam konvertieren, ist Fakt, sagt eine Extremismusforscherin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Zu beobachten sei aber seit ein paar Jahren, dass auch immer mehr unverheiratete Frauen diesen Weg gehen würden. Wie groß der Zulauf ist, dazu gibt es keine Statistiken. Es sei eine Welle von Konversionen, die wir derzeit sehen, sagen IslamexpertInnen. Während dem Christentum in Europa seit Jahren die Anhänger scharenweise davonlaufen, ist der Islam trotz der negativen Schlagzeilen offenbar so anziehend wie selten zuvor.
Sicherheitsbehörden sehen vor allem in Konvertitinnen eine wachsende Gefahr. Viele von ihnen würden Halt in einer neuen Identität suchen, sich dabei aber besonders schnell radikalisieren, um in ihrem neuen Umfeld als vollwertiges Mitglied akzeptiert zu werden.
Eine Pionierin der neuen Konvertitinnen-Welle ist die Kanadierin Khadija Omar. Die 20-Jährige löste vor mehr als drei Jahren mit ihrem Glaubenswechsel unter dem Hashtag #wewokeup einen Hype aus. Sie hat auf Instagram und TikTok 1,1 Millionen Follower und postet täglich Videos unter dem Account „Earth to Khadija“, wo sie ihr neues Leben als Muslima beschreibt und vor allem auch durch antiisraelische Hetze auffällt.
Omar hat zigtausende Nachahmerinnen gefunden, die sich auf TikTok als „neue Musliminnen“ präsentieren. Die Gründe sind mannigfach. Der Islam bietet mit sehr einfachen Regeln vermeintlich Halt und ein Gemeinschaftsgefühl. Islamische Fashion-Influencerinnen und Online-Prediger versprechen in einer immer komplexer werdenden Welt ein geordnetes und schönes Leben. Auf TikTok schaut das alles noch spielerisch aus – wie aus einem Märchen aus tausendundeiner Nacht. Aber je nach Umfeld der neuen Gläubigen wird ein „islamisches“ Verhalten immer rigider eingefordert. Dazu zählt: fünfmal am Tag beten, strikte Gebetswaschungen, Fasten im Ramadan, strenge Geschlechtertrennung und eine „Halal“-Ernährung. Aussteiger berichten von großem Druck, der nach und nach aufgebaut wird. Vor allem in salafistischen Zirkeln würde Unterwerfung eingefordert, berichtet eine Deradikalisierungs-Expertin.
Die Konvertitinnen unterwerfen sich freiwillig starren Rollenbildern
Aber es sind nicht nur junge Mädchen und Jungen, sondern auch viele Frauen aus dem bürgerlich gebildeten Milieu, die konvertieren. Sie unterwerfen sich freiwillig starren Rollenbildern, die völlig konträr zur Gleichberechtigung der Frauen im Westen stehen.
Auch der Gaza-Krieg spiele neuerdings eine Rolle. Er löste eine Welle von neuen Konversionen aus. Das Phänomen ließ sich schon bei IS-Terroristen aus dem Westen beobachten, die nach Syrien in den Kampf zogen. Darunter waren rund zwanzig Prozent Konvertitinnen und Konvertiten. Der sogenannte Islamische Staat hatte über das Internet regelrechte Werbekampagnen gestartet, die ihn als Paradies anpriesen, in dem edle Dschihadisten für Allah kämpfen, Frauen geachtet und „nicht nur auf ihren Körper reduziert“ würden.
Viele muslimische Influencerinnen agieren aber nicht ausschließlich als fromme Ich-AGs, sondern sie sind vernetzt und werden von Vereinen und Organisation unterstützt. Es werden spezielle Seminare für Islam-Content angeboten, es gibt Treffen und den Austausch von Inhalten. Staatsschützer sagen, dass hier die unterschiedlichsten islamischen Akteure starken Einfluss auf den Content nehmen, die Finanzierung käme zum Teil auch aus dem Ausland, wie etwa den Golfstaaten. Mit den weiblichen Influencerinnen habe man ein effektives neues Werkzeug, um das fundamentalistische Islamverständnis noch breiter in westlichen Gesellschaften streuen zu können. Sie sind der freundliche Gegenpol zu den alten bärtigen männlichen Scheichs. Mit Hass und Hetze werden sie nicht in Verbindung gebracht, ihre fanatischen Botschaften sind aber nicht weniger gefährlich. Sie werden nur in ein neues Geschenkpapier verpackt.
Dass die strengen Auslegungen des Islam bei jungen Muslimen auch im Alltag mehr und mehr verfangen und als Normalität wahrgenommen werden, gilt unter ExpertInnen mittlerweile als unbestritten. Wir sehen hier eine bedrohliche Entwicklung, heißt es unisono. TikTok und Instagram gelten dabei als Brandbeschleuniger. Das lässt sich vor allem in Schulen, aber mittlerweile auch an Universitäten festmachen. Zahlreiche LehrerInnen berichten von immer mehr jungen Mädchen, die plötzlich mit dem Kopftuch in die Schule kommen, oder von Jungen, die sich als Sittenwächter aufspielen und Gebetszeiten und den Ramadan einfordern. Fragt man sie, woher sie diese Informationen haben, heißt es in der Regel: aus dem Internet. Eine Lehrerin aus Wien berichtet, dass sich während des Fastenmonats Schülerinnen im Klo versteckten, um dort zu essen, aus Angst nicht vor ihren Mitschülern als Ungläubige bloßgestellt zu werden.
Fast jeder zweite Muslim unter 16 findet einen Gottesstaat die beste Staatsform
In den vergangenen Wochen kamen auch eine Reihe von deutschen Universitäten in die Schlagzeilen. Muslimische Studentenorganisationen, wie etwa an der Universität Kiel oder an der Berliner Charité, hielten dort Islam-Veranstaltungen mit strenger Geschlechtertrennung und salafistischen Predigern ab. Zahlreiche Politiker äußerten sich besorgt über den Einfluss des politischen Islam an deutschen Universitäten. Darunter war auch der neue deutsche Kanzler Friedrich Merz, der Muslime daran erinnerte, dass Deutschland ein „laizistischer Staat“ sei. Man erwarte insbesondere an den Hochschulen jenen Geist, der „unsere Gesellschaft ausmacht, nämlich Offenheit, Liberalität, Toleranz, auch religiöse Toleranz“, so der Kanzler weiter. Religiöse Toleranz?

Wie anfällig muslimische Jugendliche für islamistische Strömungen sind, zeigt auch eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) aus dem Jahr 2024. 46 Prozent der befragten Muslime unter 16 Jahren stimmten der Aussage zu, dass ein islamischer Gottesstaat die „beste Staatsform“ sei. Die Studie wurde kritisiert, da nur etwa 300 muslimische Neuntklässler teilgenommen hatten. Dennoch: Die Ergebnisse irritieren und decken sich mit den Erfahrungen von IslamexpertInnen und ExtremismusforscherInnen, die zunehmend islamistisches Gedankengut bei vielen muslimischen Jugendlichen beobachten.
Dass sich eine liberale Gesellschaft in ihrer Gesamtheit gegen islamistische Tendenzen und extremistische Strömungen, die das Grundgesetz in Frage stellen, wehren muss, darüber gibt es mittlerweile fast über alle Parteigrenzen Einigkeit. Allerdings sind die politischen Gegenmaßnahmen noch viel zu lasch. Anfangen müsste man in den Schulen, wo die Religion außerhalb des Religionsunterrichtes keinen Platz mehr haben darf. Und es geht bis hin zu den Islam-Verbänden, die sich viel klarer von extremistischen Lehren abgrenzen müssten – bzw. sie nicht auch noch selbst verkünden. Säkulare Muslime sollten zudem endlich sichtbarer und lauter werden, damit sich erzkonservative bis salafistische PredigerInnen nicht mehr als Vertreter aller Muslime aufspielen können.
Dazu sollte endlich über ein sinnvolles Verbotsgesetz für den politischen Islam erwogen werden. Ein wesentlicher Punkt: Plattformbetreiber wie TikTok müssen gegen extremistische Inhalte härter in die Pflicht genommen werden.
Um für politische Lösungen Druck aufzubauen, braucht es freilich ein Problembewusstsein quer durch alle Bevölkerungsschichten, oder wie es Zeinab ausdrückt: „Niemand kann mir vorschreiben, wie ich lebe, was ich glaube, oder wie ich mich kleide. Das ist meine Privatsache und geht niemanden etwas an. Dieses Recht bietet mir aber nur eine offene und liberale Gesellschaft. Und dieses Recht dürfen wir uns von demokratiefeindlichen Islamisten und selbsternannten Religionspolizisten nicht nehmen lassen.“