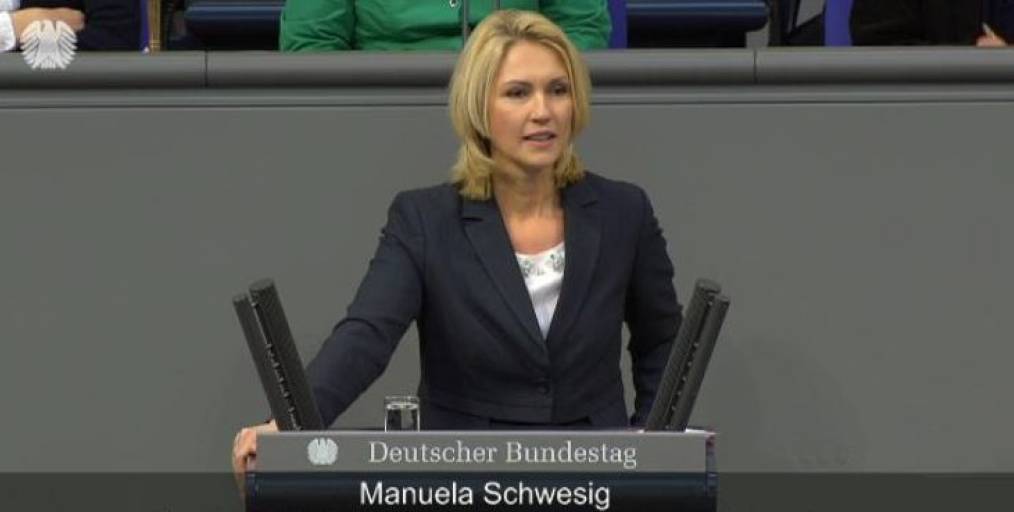Diversity: „Aus dem Ruder gelaufen!“
Beim Berliner Christopher Street Day haben sich in diesem Jahr viele Unternehmen als Sponsoren zurückgezogen, beim Kölner CSD ist FORD zum ersten Mal nicht mehr dabei. Begründung: Die Mutter-Unternehmen aus den USA hätten das bisherige Engagement in Sachen Diversity verboten. Was sagen Sie dazu?
Thomas Sattelberger Ich sehe das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Weinend deshalb, weil es zeigt, dass Unternehmen nicht zu den Werten stehen, die sie öffentlich mit ihrem Engagement bekundet haben. Sie haben also „Regenbogen-Washing“ betrieben. Lachend, weil ich denke: Etliches an Fehlentwicklung wird korrigiert. Man darf nicht ausblenden, dass vor allem in den USA, aber auch in Deutschland die Debatte zum Thema Diversity Maß und Mitte verloren hat. Da ist was aus dem Ruder gelaufen.
Wo zum Beispiel?
Im Leistungssport, wo Transfrauen, also transidente Männer, plötzlich in US-Frauenteams antraten. In Deutschland, wo männliche Gewalttäter nach dem Selbstbestimmungsgesetz mühelos ihr Geschlecht ändern konnten. Insbesondere an den Hochschulen ist die Sache aus dem Lot geraten, als das Thema Transrechte wichtiger wurde als Frauenrechte. Der sogenannte „Queerfeminismus“ macht ja das Frausein zu einer Beliebigkeit. Frauenrechte werden von dieser Bewegung mit Füßen getreten. Und traditionelle Frauenverbände wie Terre des Femmes wurden ideologisch gedreht. Mächtige Frauenverbände wie der Deutsche Frauenrat haben nicht gegengehalten. Da mache ich ihnen einen großen Vorwurf. Die hysterisch geführte Trans-Debatte überlagert das Thema der Frauen. Dabei geht es ja beim Thema „Trans“ nur um einen Bevölkerungsanteil im Promille-Bereich. Während es beim Thema Frauen um leicht über 50 Prozent geht, also die Mehrheit der Bevölkerung. Gleichberechtigung ist zudem auch noch verfassungsrechtlich garantiert. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich nicht auch für die Rechte der Transsexuellen eintrete.

Ihr alter Arbeitgeber, die Telekom, hat einen „Transgender Guide“ herausgegeben. Darin empfiehlt Telekom zum Beispiel, die Arbeitskollegin nicht mit „Frau Müller“ anzuschreiben, weil man nicht weiß, ob sie sich überhaupt als Frau identifiziert. Da dürften sich doch 98 Prozent der MitarbeiterInnen fragen, was das soll.
Wenn das eine offizielle Verlautbarung der Deutschen Telekom war, dann ist das überaus dümmlich. Das hätte es zu meinen Zeiten nicht gegeben. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mögen sich allerdings im Stillen fragen, was das soll, sprechen es aber nicht aus, weil sie wissen, dass das sozial nicht erwünscht ist. Der Konformitätsdruck ist extrem hoch und da müssen sie erstmal gegenhalten.
Wie funktionieren diese sogenannten „Diversity, Equity, Inclusion“-Programme, kurz: DEI, denn eigentlich?
Das kann zum Beispiel eine Schulung sein: Man zeichnet verschiedene kulturspezifische oder geschlechtsspezifische Kommunikationsstile per Video auf und diskutiert anschließend, was sie jeweils bei einem selbst auslösen. Das wäre eine fortschrittliche Art, sich mit Stereotypen auseinander zu setzen. Aber es gibt auch sektenhafte Schulungsprogramme, in denen Menschen bloßgestellt werden. Die erinnern an die Zeiten von Mao Tse Tung, in denen die Menschen öffentlich bekennen mussten, welche Irrtümer sie begangen haben. Es hängt von der Qualität der jeweiligen Zuständigen ab, wie so ein Programm gestrickt ist.
Das ganze Interview mit Thomas Sattelberger in der September-/Oktober-Ausgabe!