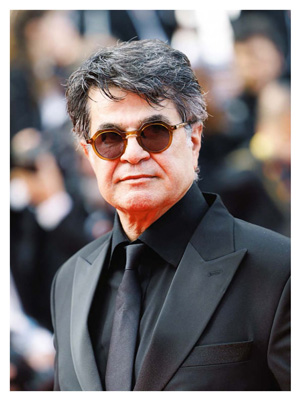Die Tochter von Lisa Müller war keineswegs das, was man einen Tomboy nennt. „Sie war nicht burschikos“, erzählt die Mutter. „Sie war nur einfach nicht so tussihaft wie andere Mädchen.“ Und da gab es noch einen Unterschied, vielleicht den entscheidenden: „Die anderen Mädchen haben ständig versucht, den Jungs zu gefallen. Lea hat das nicht gemacht.“ Die Strafe folgte auf dem Fuß. Lea wurde „von den Jungs gemobbt. Es herrschte eine toxische, sehr sexistische Atmosphäre in der Klasse“.
Bald darauf, Lea war gerade 16 geworden, präsentierte das Mädchen ihren Eltern ihre Lösung für das Problem. „Sie hat uns erklärt, dass sie ihren weiblichen Körper hasst und eigentlich ein Junge sei.“ Die Tochter erzählte ihren Eltern auch, dass sie sich schon zweimal in ein Mädchen verliebt hatte. Das sei doch kein Problem, versicherten die Eltern. Aber Lea sagte, „es pisst sie an, als Lesbe gesehen zu werden“. Fazit: Lea wollte Hormone und OPs, und das möglichst bald.
Die Mutter war bestürzt. Weniger, weil ihre Tochter den Wunsch nach einem Leben als Junge geäußert hatte. Was Lisa Müller zutiefst beunruhigte, war die Tatsache, dass „dieses Trans-Thema bei ihr wie aus dem Nichts aufgetaucht ist“. Beim Durchforsten der einschlägigen Internet-Foren stellte sie überrascht fest, dass es vielen Eltern so geht wie ihr (siehe Interview S. 61). Das Phänomen hat seit kurzem sogar einen Namen: „Rapid Onset Gender Dysphoria“ (ROGD): „Plötzlich einsetzende Geschlechtsdysphorie“.
Trans ist Trend
Lea ist kein Einzelfall. Im Gegenteil: Die Zahl der Jugendlichen, die in den auf Gender Trouble spezialisierten Kliniken auftauchen und erklären, das Geschlecht wechseln zu wollen, ist in den letzten Jahren in die Höhe geschnellt.
In der „Sprechstunde für Geschlechtervarianz“ der Uniklinik Münster werden jährlich über 150 Kinder und vor allem Jugendliche vorstellig. Bei Annette Richter-Unruh, Professorin für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni Bochum, stellten sich 2019 über 200 „transidente“ Kinder vor – 2006 waren es noch drei. Und in der ambulanten Spezialsprechstunde für Kinder und Jugendliche mit Geschlechtsdysphorie an der Münchner Universitätsklinik war die Zahl der Neuanmeldungen von PatientInnen so groß, dass die Warteliste wegen der unzumutbar langen Wartezeiten dort vorübergehend geschlossen werden musste. „Wir werden überschwemmt von Anfragen“, erklärt der Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Alexander Korte, Leiter der Sprechstunde. Da die vier spezialisierten Ambulanzen an den Unikliniken in München, Münster, Frankfurt und Hamburg den Andrang nicht mehr bewältigen, haben inzwischen in ganz Deutschland Kliniken und TherapeutInnen ihr Angebot entsprechend auf Transgender erweitert.
Das ist aber noch gar nichts gegen die Entwicklung in den USA und Großbritannien. Dort hat der Sturm auf die Gender-Ambulanzen Orkanstärke angenommen. An amerikanischen High Schools geben heute zwei von 100 SchülerInnen an, transgender zu sein, hat das staatliche „Center for Disease Control and Prevention“ ermittelt. Und der Londoner „Gender Identity Development Service“ (GIDS) hat eine Statistik veröffentlicht, deren steile Kurve der Eiger Nordwand gleicht. In acht Jahren hat sich die Zahl der dort behandelten Kinder und Jugendlichen mit Geschlechtsdysphorie verfünfundzwanzigfacht: Von 50 in 2009 auf 2.016 in 2017.
Eine Zahl ist besonders auffällig: Überall sind es heute vor allem Mädchen, die ihren Körper verändern wollen. Mädchen in der Pubertät. Mädchen wie Lea.
Lange Zeit waren Mann-zu-Frau-Transsexuelle in der Überzahl, die meisten „Transitionierten“ im Erwachsenenalter. Heute sind drei von vier Jugendlichen, die sich „im falschen Körper“ fühlen, weiblich. Tendenz steigend. Was ist da los?
Die Antwort, die der Münchner Oberarzt Alexander Korte gibt, ist alarmierend (siehe Interview S. 59). „Man trägt an viele der betroffenen Kinder heran, dass sie ‚trans‘ sind, weil sie sich nicht rollenkonform verhalten“, sagt der Mediziner. Er findet es positiv, dass die Gesellschaft gegenüber Kindern und Jugendlichen, deren Geschlechtsidentitätsgefühl nicht im Einklang zum Körper steht, offener und aufgeklärter geworden sei. Doch das sei „total gekippt in einen regelrechten Trans-Hype“.
In der Tat: Trans ist Trend. Zahllose TV-Dokumentationen zeigen Kinder und Jugendliche auf dem Weg ins andere Geschlecht. Sie haben Titel wie: „Trans is beautiful“ oder „Transgender – Mein Weg in den richtigen Körper“. Und der Berliner Lesben- und Schwulenverband (LSVD) hat gemeinsam mit dem „Bündnis gegen Homophobie“ in diesem Sommer sogar die Kampagne „Proud to be Trans*“ lanciert.
Wechsel statt Befreiung?
Das Mädchen ist dann eben kein Mädchen mehr, wenn es sich für Physik oder Fußball interessiert; wenn es mit kurzen Haaren und kräftigem Körper nicht ins Barbie-Schema passt; oder wenn es sich in andere Mädchen verliebt. Und da es kein „richtiges“ Mädchen ist, muss es folglich ein Junge sein. Für die meisten gibt es offenbar immer noch nur diese zwei Schubladen. Und so wird die Rollenbrecherin qua „Transition“ wieder auf Linie gebracht.
Doch der Preis für diese „Anpassung“ ist hoch. Um körperlich zum Jungen bzw. Mann zu werden und es auch zu bleiben, muss das biologische Mädchen lebenslang Hormone nehmen, womöglich lässt es sich chirurgisch Brüste und Gebärmutter entfernen.
Es ärgert Alexander Korte, dass „der Eindruck erweckt wird, dass das mal eben komplikationslos gemacht werden kann“. Speziell bei den so genannten Pubertätsblockern, die hormonell vorübergehend verhindern, dass sich die sekundären Geschlechtsmerkmale entwickeln, fehlten Studien zu den Auswirkungen bei dieser PatientInnengruppe, warnt Korte. „Wir wissen gar nicht, was wir damit anrichten.“
Aber nicht nur die körperlichen Folgen sind fragwürdig, auch die gesellschaftlichen Konsequenzen sind gravierend. „Geschlechter-Stereotype werden wieder festgeschrieben“, klagt Korte, selbst Vater zweier Töchter. Mehr noch: „Das Ganze ist aus meiner Sicht ein Homosexualitäts-Verhinderungsprogramm.“
Vor etwa zehn Jahren begannt der Trend zu Trans. Im Juni 2014 rief das amerikanische Time Magazine den „Transgender Tipping Point“ aus: den Wendepunkt in Sachen Transgender. Untertitel: „Americas next civil rights frontier“. Sprich: Nach dem erfolgreichen Kampf um die Bürgerrechte von Schwarzen, Frauen und Homosexuellen seien jetzt die Transgender an der Reihe.
Auf dem Titel posierte kurvenreich im engen blauen Kleid Laverne Cox, die Schauspielerin, die in der Netflix-Serie „Orange is the New Black“ die transsexuelle Gefängnisinsassin Sophia spielte. Cox erklärte: „Es geht vor allem darum, das Patriarchat zu verändern.“
Ein Jahr später titelte auch Vanity Fair mit einem Trans-Coming Out: Der in den USA berühmte Zehnkämpfer Bruce Jenner ließ sich mit chirurgisch verweiblichtem Körper und feingeschnittenem Gesicht in cremefarbener Corsage ablichten und bat: „Call me Caitlin.“ Caitlin Jenner erklärte, sie habe „schon immer ein weibliches Gehirn“ gehabt, wolle jetzt „ganz Frau sein“ und freue sich nun am meisten darauf, endlich „Nagellack so lange zu tragen, bis er abblättert“. Das Patriarchat verändern wollte Jenner ganz offensichtlich nicht.
Die Debatte darüber, ob eine OP plus Nagellack einen biologischen Mann zur „echten Frau“ mache und was überhaupt eine „Frau“ sei, bewegte nun Amerika und bald darauf die ganze westliche Welt. Die Antwort von Feministinnen lautete: Entscheidend ist die Lebenserfahrung als weiblicher Mensch.
In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2011 entschieden, dass eine Operation nicht länger zwingende Voraussetzung dafür sein darf, ob ein Mensch amtlich im anderen Geschlecht leben darf. Um eine so genannte Personenstandsänderung vornehmen zu können, genügt es laut deutschem Transsexuellengesetz inzwischen, sich „dauerhaft dem anderen Geschlecht als zugehörig zu empfinden“. Die Person muss „seit mindestens drei Jahren unter dem Zwang stehen, ihren Vorstellungen entsprechend zu leben“, und es muss „mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen“ sein, dass „sich das Zugehörigkeitsempfinden zum anderen Geschlecht nicht mehr ändern wird“.
Eigentlich ein fortschrittliches, ein begrüßenswertes Urteil. Warum sollte sich ein Mensch, der sozial in der anderen Geschlechterrolle leben will, dafür hormonellen und chirurgischen Eingriffen unterziehen müssen? Doch der Schuss ging nach hinten los.
In den USA erreichte die Trans-Community durch beharrliche Lobbyarbeit, dass Präsident Obama eine Richtlinie verabschieden wollte, die besagte: sex = gender identity. Will heißen: Um zu einem biologischen Geschlecht zu gehören, reicht es, sich einfach selbst sozial als dieses Geschlecht zu definieren.
Amerikanische Feministinnen liefen Sturm gegen die Richtlinie. Sie fürchteten, dass der vermeintlich fortschrittliche Plan in Wahrheit zum fatalen Rückschritt für Frauen würde. „Wenn biologisches Geschlecht und Gender-Identität gleichgesetzt werden, bedeutet das, dass fast alle Räume, die für Frauen reserviert sind, verschwinden werden: Frauen-Colleges, Frauen-Teams im Sport, getrennte Schlaf- oder Umkleideräume“, erklärte die „Women’s Liberation Front“. Denn tatsächlich könnte ein biologischer Mann, der erklärt, sich als Frau zu fühlen, sich den Zugang zur Damenumkleide verschaffen – und notfalls erklagen. So in den USA bereits geschehen. Oder: Biologische Frauen, die als Männer leben, könnten sich an einer Frauenuni einschreiben. So geschehen am berühmten Frauencollege Mills, wo die Vorsitzende der Studierendenvertretung jetzt ein Transmann ist.
Und schließlich, so die „Women’s Liberation Front“, sei das Konzept sex = gender identity ein Angriff „auf Frauenrechte generell. Denn es bedeutet, dass Mädchen und Frauen nicht mehr als gesellschaftliche und politische Kategorie existieren werden, deren Rechte geschützt sind. Das ist ein absolutes Desaster.“ Die Frauenorganisation klagte 2016 gegen Obamas Richtlinie – und gewann. Doch obwohl die Bestimmung nicht in Kraft trat, arbeiten Trans-AktivistInnen weiter daran, die gesellschaftliche und politische Kategorie „Frau“ auszulöschen – mit wachsendem Erfolg.
Da sind auf der einen Seite fanatisierte Transmänner, die weibliche Symbole und Begriffe nicht nur für sich persönlich, sondern für alle verbannt wissen möchten. In den USA wurden Frauenberatungsstellen, auch solche, die zum Thema Abtreibung beraten, so lange bedrängt, bis sie das Wort „Frau“ aus ihrem Namen strichen. Denn das sei „exclusive“, also ausschließend. Schließlich gebe es auch Transmänner, die schwanger werden, sich von dem Begriff „Frau“ aber ausgeschlossen fühlen könnten.
Das deutsche Missy Magazine hat diese Direktive bereits willfährig übernommen. Jüngst sprach Vagina-Expertin Mithu Sanyal in einem Artikel über Abtreibung von „schwangeren Menschen“. Dabei gehört auch das Wort „Vagina“ nach dem Willen der Trans-Community auf die Liste der verbotenen Begriffe. Denn Menschen, die sich als Frau definieren, aber keine Vagina haben, könnten sich durch die Verwendung des Begriffs diskriminiert fühlen. Stattdessen solle die Vagina als „vorderes Loch“ bezeichnet werden.
Auch weibliche Symbole sollten tunlichst von der Bildfläche verschwinden. Soeben kündigte der amerikanische Bindenhersteller „Always“ an, das Frauenzeichen von der Packung zu verbannen. Transmänner hatten protestiert und mit Boykott gedroht. Das Unternehmen „Procter & Gamble“ erklärte die Entfernung des Venussymbols, das zum Symbol für die Frauenbewegung wurde, so: „Wir stellen fest, dass sich nicht jeder, der eine Periode hat und eine Binde benötigt, als weiblich identifiziert.“ Schon im Sommer 2017, als empörte Frauen – und einige wenige solidarische Männer – gegen den Prozess gegen Gina-Lisa Lohfink demonstrierten, war im Vorfeld der Demo die Aufforderung kursiert, doch bitte auf Plakaten und Transparenten keine Frauenzeichen zu verwenden. Denn Teilnehmer, die sich nicht als Frauen definierten, könnten sich von dieser Symbolik ausgeschlossen fühlen.
Auf der anderen Seite drängen als biologische Männer geborene Transfrauen in Frauengruppen – und bestimmen von da an nicht selten die Agenda.
Für Feministinnen, die sich gegen die Auslöschung der Kategorie Frau und ihrer feministischen Anliegen durch diese Art Trans-Aktivismus zur Wehr setzen, hat die militante Trans-Community ein Schimpfwort kreiert: „Trans Exclusionary Radical Feminist“, kurz: TERF. Der Hass auf TERFs ist groß. „Punch a TERF!“ (Schlag eine TERF!) oder gar „Kill a TERF!“ (Töte eine TERF!), das sind Parolen, die in einschlägigen Foren getwittert oder auf (blutroten) T-Shirts getragen werden. Und immer wieder folgen den Worten auch Taten.
Wer als TERF oder „transphob“ gebrandmarkt ist, kann in „fortschrittlichen“ Kreisen schon mal den Job verlieren. Wie die lesbische Aktivistin Julia Beck aus Baltimore, die aus der städtischen LGBTQ-Kommission flog, weil man ihr „gewalttätiges Verhalten“ vorwarf. Ihr Vergehen: „Ich hatte männliche Pronomen für einen verurteilten Vergewaltiger verwendet, der sich als transgender definierte und weibliche Pronomen bevorzugte.“ Dieser biologisch männliche Täter, der für seine Übergriffe auf Frauen bereits bekannt war, war aufgrund seiner selbstgewählten „Identität“ als Frau in einem Frauengefängnis untergebracht worden – und hatte dort zwei Frauen vergewaltigt.
Im britischen Macclesfield wurde Rebekah Wershbale aus ihrer Stammkneipe geworfen, weil sie ein T-Shirt mit der Duden-Definition für „Frau“ trug: „woman, noun, adult human female“ (Frau, Substantiv, erwachsenes weibliches Wesen). Begründung für den Rausschmiss: „Transphobie“. Rebekah Wershbale ist eine von vielen homosexuellen Frauen, die in Großbritannien gegen die Aushöhlung von Frauenrechten durch gewisse TransaktivistInnen kämpft. Ihre Initiativen heißen „Fair Play For Women“, „ReSisters Unite“ oder „Get The L Out“.
„Das L muss aus der Buchstabenreihe LGBTQI raus, damit Lesben ihre Interessen wieder eigenständig vertreten können“, erklärt Liane Timmermann, Aktivistin bei „Get The L out“. Die Queer-Community ist darüber not amused: Beim diesjährigen Gay Pride Marsch in London waren die lesbischen Aktivistinnen nicht erwünscht und wurden auf Weisung der Veranstalter von PolizistInnen aus der Demo gezogen. „Dabei hatten uns viele Lesben applaudiert“, sagt Liane Timmermann. Nach jeder Veranstaltung, auf der „Get The L Out“ mit ihrem Transparent „Lesbian, not Queer“ auftauchen, „bekommen wir Hunderte zustimmende Mails“.
Auf dem LesbenFrühlingsTreffen 2019 (LFT) in Köln gab es einen heftigen Eklat über einen Workshop mit dem Titel „Werden Lesben unsichtbar (gemacht)?“ Die Mädchenpädagoginnen Trude Schmitz und Sylvia Rati hatten den Workshop wie folgt angekündigt: „In unterschiedlichen Bereichen der Mädchenarbeit beobachten wir das Verschwinden von lesbischen Mädchen. Mädchen nennen sich eher Queer oder Transgender/=hetero. Es ist spürbar, dass sich lesbisch zu nennen, (wieder) vermehrt angstbesetzt ist.“ Auch die Mädchenpädagoginnen hatten beobachtet, dass „bei jungen Mädchen, die sich nicht an die ihnen zugewiesenen Rollennormen halten, immer öfter Genderdysphorie diagnostiziert“ werde.
Es hagelte prompt Proteste, auch deshalb, weil der Workshop sich an „Lesben, die als Mädchen sozialisiert wurden“, richtete, sprich: vormals biologische Männer ausschloss. Die LFT-Organisatorinnen wurden aufgefordert, „sich für die passierte Transfeindlichkeit zu entschuldigen“. Reaktion: Der Workshop fand zwar statt, jedoch wurde der Ankündigungstext von der Website genommen, „um weitere Diskriminierung zu vermeiden“.
Die Trans-Lobby hat ganze Arbeit geleistet. Jegliche Kritik wird mit dem Stempel „transphob“ gebrandmarkt und so im Keim erstickt. Aufschlussreich auch, dass mehrere (potenzielle) GesprächspartnerInnen für dieses Dossier entweder gar nicht oder nur anonymisiert mit EMMA sprechen wollten, aus Angst vor Druck und Sanktionen. Erstaunlicherweise ist es einer zahlenmäßig winzigen Minderheit gelungen, einen breiten gesellschaftlichen Einfluss auszuüben – und Kritikerinnen einzuschüchtern.
2.085 Menschen – dreimal so viele wie zehn Jahre zuvor – ließen 2017 in Deutschland eine Personenstandsänderung vornehmen, das sind 0,003 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren. Insgesamt liegt die Zahl der seit 1991 offiziell erfassten transsexuellen Menschen bei 24.300, das wären 0,03 Prozent Transsexuelle in Deutschland.Danach wäre jeder dreitausendste Mensch in Deutschland transsexuell.
Der Trans-Trend hat mit seinen Forderungen längst den Weg in den Mainstream gefunden. Das hat teilweise verheerende Folgen. So besagen in den USA die Leitlinien für den Umgang mit Transgender-Kindern und Jugendlichen, dass deren Wunsch nach einer „Geschlechtsumwandlung“ von Therapeuten nicht hinterfragt werden darf, sondern fraglos bestätigt werden muss. Alles andere gilt als „Konversionstherapie“, also Bekehrungstherapie, die etliche Bundesstaaten verboten haben. Folge des „transaffirmativen Ansatzes“: Je nach Staat werden dort bereits achtjährigen Kindern Hormone verabreicht und zwölfjährigen Mädchen die gerade erst sprießenden Brüste amputiert.
Auch in Deutschland wird die entsprechende Leitlinie zur Behandlung von transsexuellen Kindern und Jugendlichen gerade überarbeitet. Der Münchner Kinder- und Jugendpsychiater und Sexualmediziner Alexander Korte ist Mitglied der Experten-Kommission. Zu seinem großen Bedauern ist er eine der raren Stimmen, die den bedingungslosen „transaffirmativen Ansatz“ kritisch sehen. „Die Debatte ist komplett durchideologisiert“, klagt Korte. Auch kritische Forschung habe es deshalb schwer.
So schlug der Gynäkologin Lisa Littman, Professorin für Verhaltens- und Sozialforschung an der renommierten Brown University in Providence, ein Shitstorm entgegen, als sie im August 2018 eine Studie veröffentlichte, für die sie 256 Eltern von Transgender-Jugendlichen befragt hatte. Littman war aufgefallen, dass auffallend viele Jugendliche im selben Freundeskreis nach Eintreten der Pubertät plötzlich erklärten, „transgender“ zu sein und mit Hormonen und OPs das Geschlecht wechseln zu wollen. Auch wenn es – wie bis dato der Regelfall – in deren Kindheit keinerlei Anzeichen für eine „Geschlechtsdysphorie“ gegeben hatte, also ein „Leiden“ am eigenen Körper. Littmans These, die auch Korte seit langem vertritt: Es steckten häufig ganz andere Probleme hinter dem Wunsch nach „Transition“ und der so plötzlich gewünschte Geschlechtswechsel könne zum Beispiel eine „Bewältigungsstrategie“ sein. Besonders Mädchen schienen betroffen: Acht von zehn Jugendlichen, von denen die befragten Eltern berichteten, waren weiblich. Littman gab dem Phänomen einen Namen: „Rapid Onset Gender Dysphoria“ (ROGD), also eine plötzlich auftretende Geschlechtsdysphorie.
Der Protest der Trans-Community ließ nicht lange auf sich warten. Was nicht weiter überraschend war. Erstaunlich war hingegen, dass die Brown University den Hinweis auf die Studie prompt von ihrer Website löschte. Das Wissenschaftsmagazin PLOS One, das die Studie veröffentlicht hatte, ließ Littmans Untersuchung noch einmal auf ihre wissenschaftlichen Standards hin überprüfen. Resultat: Methodisch war die Studie einwandfrei, sie wurde nur sprachlich leicht geglättet.
Langsam dringen immer mehr kritische Stimmen an die Öffentlichkeit. So schlugen im Oktober 2019 vier Angestellte der Londonder Tavistock Klinik Alarm. Ihr Vorwurf: In dem an die Klinik angedockten „Gender Identity Development Service“ (GIDS) – der heute 25 mal so viele PatientInnen behandelt wie noch vor zehn Jahren – würden Kinder und Jugendliche fehlbehandelt und erhielten viel zu schnell Pubertätsblocker. „Viele dieser Kinder haben eigentlich andere Probleme wie Depressionen, Autismus, ein erlittenes Trauma durch sexuellen Missbrauch oder internalisierte Homophobie. Doch diese Faktoren werden nicht in Betracht gezogen“, erklärt Psychotherapeutin Sue Evans. Der Druck auf das Personal, die Warteliste schnell abzuarbeiten, sei riesig, so Evans. Sie kündigte ihren Job bei der GIDS. Ihre Kollegin Kirsty Entwistle beklagte in einem Offenen Brief ebenfalls, die Diagnose Genderdysphorie werde viel zu leichtfertig gestellt, und „Angestellte, die das kritisierten, werden als ‚transphob‘ gebrandmarkt“.
Inzwischen melden sich auch diejenigen zu Wort, die Opfer der Trans-Propaganda geworden sind: die so genannten Detransitioner. Also diejenigen, die nach einigen Jahren Leben im anderen Geschlecht feststellen, dass die Transition keineswegs die Lösung ihrer Probleme war. Während die meisten Detransitioner sich noch zaghaft in Internet-Foren austauschen, ist Charlie Evans nach vorne gegangen. Die 28-jährige Biologin, die sich mit 17 (äußerlich) in einen Jungen verwandelte, lebt jetzt wieder als Frau. Sie kritisiert offen „die Bewegung, die Kindern, die nicht in die gängigen Geschlechterrollen passen, erklärt, sie seien im falschen Körper geboren“
13 Jahre später will Charlie Evans all jene unterstützen, die wie sie, Opfer der Geschlechterstereotype geworden sind – und Opfer von Ärzten, die diese Ideologie nicht in Frage stellen. Am 30. November hat Charlie in Manchester das „Detransition Advocacy Network“ gegründet.
Auch kritische Transsexuelle machen auf die „aus dem Ruder gelaufene“ Entwicklung aufmerksam. „Leider bekomme ich mehr Fälle von Detransitionen mit, bei denen die Gründe für die Transition oft in unaufgearbeitetem sexuellen Missbrauch oder Mobbing oder auch internalisierter Misogynie liegen“, berichtet Till Amelung. Der Gender-Wissenschaftler und Transmann moderiert ehrenamtlich im Team die größte deutschsprachige Transgruppe auf Facebook und klagt: „Zu meinem Entsetzen wird eine differenzierte Diskussion abgewiegelt“
Wird auch Lea Müller eines Tages zu den Detransitionern gehören? Ihre Mutter Lisa hat gerade eine Selbsthilfegruppe für Eltern von Kindern mit „Rapid Onset Gender Dysphoria“ gegründet. Die Initiative „Parents of ROGD Kids“ kommt ursprünglich aus den USA, jetzt gibt es Dank Lisa Müller auch einen deutschen Ableger. „Es hilft, wenn man merkt, dass man nicht alleine ist“, sagt sie.
Tochter Lea ist inzwischen volljährig und ihre Eltern können ihr weder das Testosteron noch die Operationen verbieten. Wäre Mutter Lisa sicher, dass ihre Tochter zu den Menschen gehört, für die eine Transition tatsächlich der einzig erträgliche Weg ist, würde sie sie unterstützen. „Wir haben kein Problem damit, wenn unsere Kinder transitionieren“, erklärt sie. „Wir haben ein Problem damit, dass sie das später bereuen könnten. Das ist die Katastrophe.“ Chantal Louis