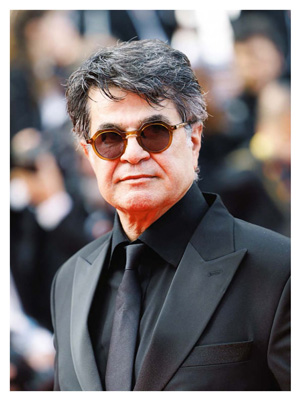Der Trend geht zum Androgynen
Horst und Helga haben nicht so viel miteinander zu tun wie Luca und Leonie. Und das liegt nicht etwa daran, dass sich Horst und Helga, die mittlerweile im Rentenalter sind, im Laufe vieler Jahrzehnte auseinander gelebt haben. Es liegt auch nicht daran, dass Luca und Leonie sich so nahe sind, weil sie jeden Morgen gemeinsam im Kindergarten spielen. Nein, nur wenn man sich nicht die Menschen hinter den Namen anschaut, sondern die Namen vor den Menschen – dann erkennt man zwischen Luca und Leonie verblüffende Ähnlichkeiten.
Zumindest, wenn man Vornamen linguistisch untersucht, wie Damaris Nübling, Professorin für Historische Sprachwissenschaft des Deutschen an der Universität Mainz. Sie hat in zwei Studien – die in diesen Wochen in den "Beiträgen zur Namenforschung" und im "Deutschunterricht" erschienen – eine Theorie erhärtet, die sich auf Lea, Lena, Leon, Jan und all die anderen Krabbelstubenkinder einen Reim macht. Ihre gut belegte These: Rufnamen werden immer androgyner, Jungen und Mädchen gleichen sich in ihren Vornamen lautlich an.
Das hatte schon einmal ein Namenforscher angenommen. Der Soziologe Jürgen Gerhards zeigte in seiner Studie "Die Moderne und ihre Vornamen" aus dem Jahr 2003 am Beispiel der beiden Städte Gerolstein und Grimma, wie sich Vergabe von Vornamen im vergangenen Jahrhundert verändert hat. Waren zum Beispiel Ende des 19. Jahrhunderts noch 85 Prozent der vergebenen Vornamen deutsch oder christlich, so lockerten sich die Deutschen vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg immer mehr auf. Gerhards wies die Großtrends Säkularisierung, Enttraditionalisierung, Individualisierung und Globalisierung nach. Auch zeigte er, dass spezifisch deutsche Namen (Heinrich, Karl, Otto, Edeltraud, Sieglinde, Gisela) nicht erst mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten einsetzten – sondern schon im 19. Jahrhundert zur deutschtümelnden Selbstvergewisserung aufkamen und damit gewissermaßen ein Frühindikator des übersteigerten Nationalismus im 20. Jahrhundert waren.
Schon Jürgen Gerhards wollte in seiner Studie außerdem belegen, dass Vornamen nicht mehr so geschlechtseindeutig sind. Plausibel ist das schon deshalb, weil Jungen heute zum Beispiel über den italienischen Einfluss auch ehemals weibliche Namen wie Andrea tragen und eine Ulrike heute wohl öfter denn je zuvor schlicht Uli genannt wird. Als Soziologe nur mit begrenztem linguistischem Instrumentarium ausgestattet, untersuchte Gerhards jedoch lediglich den Auslaut der Namen. -a und -e sind demnach typisch weibliche, -n, -s, -d und -r typisch männliche Rufnamen-Endungen. Allein: Zwischen 1950 und 1998 änderte sich die Markierung des Geschlechts nicht. Doris und Marion, die mit harten Konsonantenendungen Männlichkeit bewiesen, vermehrten sich nicht – die vokalisch-weiblich ausklingenden Sascha und Uwe ebenso wenig.
Es kommt eben nicht nur auf den Endbuchstaben an. Damaris Nübling, schon dank ihres seltenen Vornamens onomastisch sensibilisiert, untersuchte die zwischen 1945 und 2008 am häufigsten vergebenen Vornamen in mehreren Schritten. So sieht sie Vokale und Konsonanten auf einem phonetischen Kontinuum, auf dem stimmhafte Dauerlaute wie l, m, n, j, weil sie weicher klingen, den Vokalen näher stehen als die stimmlosen Plosive p, t, k.
Das Ergebnis des historischen Vergleichs: Der Anteil weicher Konsonanten und Vokale steigt vor allem in den siebziger und neunziger Jahren stark: Tim (2008 unter den Top Ten) ist weicher als Stefan (1975), und Stefan ist weicher als Günther (1945). Und nicht nur das: Die lieblichen Laute stehen auch nicht mehr so oft neben anderen Konsonanten (wie das l in Elke), sondern können sich zwischen Vokalen (wie das l in Julian) oder vor Vokalen (wie das l in Leah) lautlich viel freier entfalten. Und wenn man zudem bedenkt, dass die Vornamen insgesamt kürzer geworden sind, dann, so Nübling, "ballt sich maximale Sonorität auf einem minimalen Namenkörper".
Die Liste der am häufigsten vergebenen Vornamen des Jahres 2008, die von der Wiesbadener Gesellschaft für deutsche Sprache anhand der Daten von 170 Standesämtern Ende Februar zusammengestellt wurde, scheint diesen Trend auf den ersten Blick nicht zu bestätigen. Warum sollten bei dem Drang zu Kürze und Weichheit Maximilian und Alexander bei den Jungen die Plätze eins und zwei behaupten? Ganz einfach: weil die beiden Namen meist zu Max oder Alex abgekürzt werden und der helle Vokal a einfach schön klingt.
Die beliebtesten Namen des vergangenen Jahres bestätigen zwei weitere Befunde Nüblings. Erstens nehmen Hiaten (also zwei aufeinander folgende Vollvokale, die verschiedenen Silben angehören) bei beiden Geschlechtern stark zu. Der von Nübling als "Maoam-Effekt" bezeichnete Trend, 1945 nur bei Marion und Michael zu erkennen, weitet sich stark aus. Seit den Siebzigern sah man das vor allem an den -ian-Namen wie Christian oder Florian, die in Maximilian ihren Nachfolger finden. Neuerdings erkennt man den Hang zum Hiatus aber auch an Noah oder Elias, Lea oder Sophia.
Die Top Ten-Liste bestätigt zudem, dass Konsonantencluster – wie bei den ersten beiden Buchstaben von Brigitte – langsam aussterben. Unter den zehn beliebtesten Mädchennamen gibt es solche Zusammenrottungen von Konsonanten nur noch beim rl von Charlotte, unter den Jungen nur beim nd von Alexander. Auf geradezu verblüffende Weise erfüllen sich Nüblings Annahmen bei den einzigen Neuzugängen in der aktuellen Liste, Mia und Tim: kürzer geht's kaum, wohlklingender auch nicht. Hellere Vokale wird man kaum irgendwo finden, und zu allem Überfluss weist der winzige Name Mia auch noch einen Hiatus von i und a auf.
Nach dem Abschied von Namen, die aus religiösen oder familiären Motiven vergeben wurden, war die Euphonie der Dauerbrenner unter den Namenforschern. Wenn man die Kinder eben nicht mehr nach Großeltern, Paten oder Heiligen benennt, so die Annahme, gibt man sich stärker dem eigenen Empfinden hin, also auch der lautlichen Lieblichkeit. Mit der Theorie von den feminisierten Jungennamen hat man nun endlich eine Erklärung für die Fülle des Wohllauts, mit dem man seine Kinder verzärtelt: "Noch nie seit 1945", sagt Nübling, "waren sich die Rufnamen beider Geschlechter strukturell so ähnlich wie heute."
So gut diese Erklärung klingt, so viele namhafte Fragen gibt es da noch. Nennt man sein Kind Leon, weil der Name so schön weiblich klingt? Oder weil er einfach nur weich klingt? "Und sind Birgit oder Astrid", so fragt Namenforscher Gerhard Müller von der Gesellschaft für deutsche Sprache, "wirklich schon ausgestorben, weil sie härter klingen, oder sind sie nur in den Hintergrund gedrängt?" Sicher, Wolfgang und Günther sind markiger als die weichgespülten Tim oder Paul. Aber alte Töne klingen bei Vornamen nach zwei oder drei Generationen wieder neu. Nicht umsonst toben im Berliner Trendbezirk Prenzlauer Berg so viele Wilhelms, Ottos, Konrads und Gustavs auf den Spielplätzen. Wenn diese Namen auch in Bietigheim-Bissingen und Castrop-Rauxel ankommen – dann könnte die Trend-Szene den schönen Unisex-Trend wieder zunichte machen.
Der Autor ist Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.