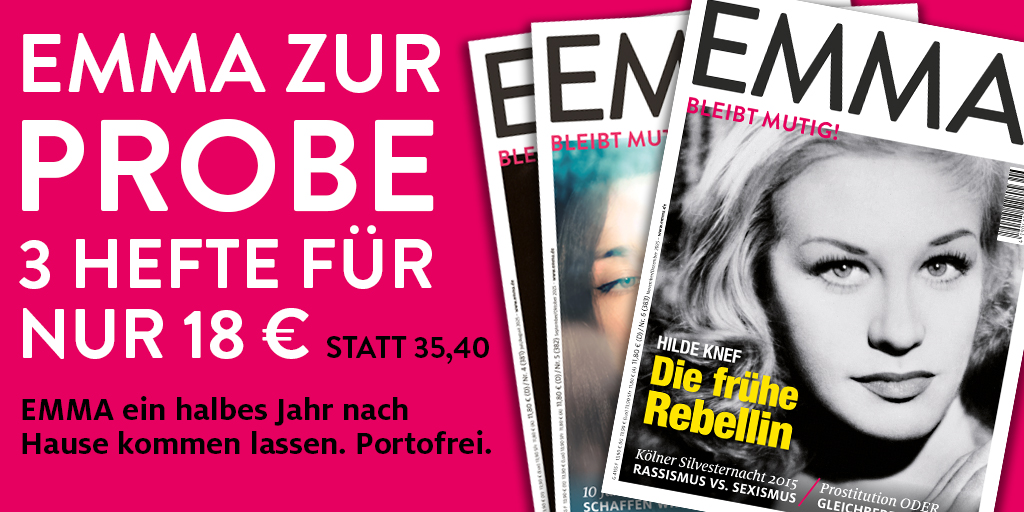Hilde Knef - zu früh emanzipiert
"Werden Wolken alt? Sind Fliegen dumm? Ist Grönland kalt – und wenn, warum? Sprechen Enten im Schlaf? Wird der Mond auch mal müde? Sind Grashalme einsam? Wer macht den Himmel trübe?“
1965 schreibt Hildegard Knef ihren ersten Songtext „Werden Wolken alt“, den sie im Stakkato hervorstößt. Ohne Lächeln in der Stimme, ohne dieses Berliner Kieksen, das sie immer dann einschaltet, wenn es kitschig werden könnte. In einer Fernsehaufnahme aus den Sechzigern sitzt sie in einem Flugzeug und singt die nächste Strophe mit Blick in die Wolken.
„Hat ein Hut Bekannte oder lebt er allein? Haben Möwen Verwandte? Kann eine Schulter traurig sein?“
Der Ton macht klar: Hier geht es nicht um ein beschwingtes Liedchen, auch wenn Klavier und Klarinette jubilieren, sondern um Existenzielles. Fragen, die sie auch ihrem Großvater hätte stellen können, besonders die letzten:
„Warum stirbt das Kaninchen, der Mensch, eine Ziege? Warum ist nie etwas ewig, außer der Lüge? Die Lüge die Antwort zu kennen, die Dinge beim Namen zu nennen.“
Ihr Großvater, ja, er war der einzige, dem sie solche Fragen hätte stellen können.
„Meiner hieß Karl, er war mittelgroß und genauso kräftig wie er aussah. Sein Jähzorn war das Schönste an ihm, erstens weil er sich nie gegen mich richtete und weil er so wild und rasch kam, wie er verging, und wenn vergangen, wurde sein Gesicht warm wie ein Dorfteich in der Sommersonne und seine Bewegungen verlegen und einem fischenden Bären gleich.“
Mit diesen Sätzen beginnt Hildegard Knef 1970 ihre Lebenserinnerungen „Der geschenkte Gaul“. Zu jung für persönliche Schuld, voller Scham über den Holocaust, wird ihre Biografie zur Projektionsfläche für eine ganze Generation werden. Und doch beginnt alles mit dieser ganz und gar einzigartigen Beziehung zum Großvater. Sie waren wie zwei Verschwörer, der alte Mann und das kleine Mädchen, sie duldeten keine Hierarchien zwischen sich, Kategorien von „männlich“ und „weiblich“ existierten nicht für die beiden.
"Ich habe meinen Großvater nie in ‚männlichen Gesprächen‘ gesehen, er mochte Männer nicht, spielte nicht Karten und hasste alle Verbrüderungen.“ Ihre Meinung bedeutete ihm etwas, er nahm sie so ernst wie Hilde seine Wutanfälle genoss. „Wir beteten uns gegenseitig an, über die uns trennenden sechzig Jahre hinweg.“
Einsame Kinder alle beide, die kleine Halbwaise, die von der Mutter einen Stiefvater vorgesetzt bekam, „weil sich das so gehörte“, und der herumgestoßene Junge aus Ostpreußen, Sohn eines Bankrotteurs und Säufers. Den Sommer verbrachten sie gemeinsam in der Laube in Zossen, einem Gartengrundstück mit Obstbäumen, Teich, Kohl und Spargel. Bevor er sich mit 81 umbringt, zermürbt vom Krieg und abgrundtiefer Hoffnungslosigkeit, schreibt Karl der Enkelin einen langen Brief. Er sei „zu alt, um die Grausamkeiten vergessen zu können und um Dir noch nützlich zu sein …“ Er allein hat ihr immer Mut gemacht, das zu werden, was sie später wird – die Knef.
Das schwarze Paillettenkleid flimmert, im weißen Gegenlicht fluoreszieren ihre nackten Arme, sie wirft den Kopf zurück, hinter ihr die Bigband von Kurt Edelhagen. „Für mich soll’s rote Rosen regnen“, singt sie und der Dreivierteltakt tanzt mit ihrem Sprechgesang Walzer. „Mir sollen sämtliche Wunder begegnen …“ Knefs Stimme füllt den Raum, tief, rauchig, ein Augenzwinkern in der Stimme. Berliner Schnoddrigkeit ist darin, aber auch viel Untröstliches, Verzweifeltes, Aufbegehren und Melancholie.
Mit diesem Song, der Hymne ihres Lebens, schlägt sie den Bogen von der Berliner Göre zum Vamp des deutschen Nachkriegskinos, zum Hollywood- und Broadwaystar; der Song fasst ihre Einsicht in die Volten des Lebens in Worte, eines Lebens, das sie immer vorwärts gelebt und erst rückwärts verstanden hat. So gut verstanden, dass sie am Ende wieder bei der Anfangsstrophe angekommen ist.
„Ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles, oder nichts.“
Keine Kompromisse, in einem Paukenschlag verklingt der Ton. Es geht ein bisschen unter, dass sie in der vorletzten Strophe den Refrain „mir sollen sämtliche Wunder begegnen“ variiert und „mir sollten ganz neue Wunder begegnen“ daraus macht. „Mich fern vom alten neu entfalten“. Das ist Knefs Wunsch, against all odds.
Rund 100 Chansons und sieben Bücher hat sie geschrieben, von ihrem ersten Songtext „Werden Wolken alt“ bis zur Musicalfassung ihrer Autobiografie „Der geschenkte Gaul“ Anfang der 1990er Jahre. Im Grunde sind es Gegendarstellungen zu all den Klischees, die über sie kursieren. Zum Bild, das sich andere, das deutsche Publikum, männliche Kommentatoren zumal, von ihr gemacht haben.
„Wenn Sie erlauben, möchte ich eine Charakterisierung von Ihnen versuchen: naiv und trotzdem sehr berechnend, trotzig, unabhängig, aber gleichzeitig auch wieder anlehnungsbedürftig, tapfer, keine Frage, aber doch auch gelegentlich verzweifelt …“, ein Fernsehjournalist bläst ihr diese Worte überlegen lächelnd mit seinem Zigarettenrauch ins Gesicht. Eigentlich müsste sie aufstehen und gehen, so anmaßend klingt das, aber sie sagt nur trocken: „Sie machen aus mir 24 Personen auf einmal!“
Immer aber fürchtet sie das Etikett. Selbstbestimmt, das ja, aber Feministin? „Wenn ich nochmal auf die Welt komme, will ich ’n Mann sein, dann hört die Fummelei an den Haaren auf“, sagt sie zu ihrem Visagisten René Koch. Aber eigentlich lebt sie ja längst ein Männerleben, sucht sich in ihrer „Piratenzeit“ Ende der Fünfziger die Männer selbst aus, verdient ihr eigenes Geld – und steht für ihre Fehler allein gerade. Sie ist keine Aktivistin, Alice Schwarzers Lob von der „zu früh Geborenen“ will sie sich auch später nicht anheften, aber sie gibt anderen Frauen ein Beispiel der Selbstermächtigung: Als eine der wenigen Frauen ihrer Generation, die den Backlash vom emanzipierten Frauenbild der Zwanziger zum „Heimchen am Herd“ in den Nachkriegsjahren nicht mitmachen wollen.
Alles oder nichts. Das lernt sie früh, die schmale, honigblonde Berlinerin mit dem strahlenden Silberblick. Aus der Schusterwerkstatt ihres Stiefvaters träumt sie sich weg. In eine glitzerndere Welt, zuerst will sie malen, dann Schauspielerin werden, Ufa-Star! „Die sieht nett aus“, sagt Goebbels, woraufhin die 17-Jährige in einem Ufa-Film mitspielen darf, eine Szene, die später wieder herausgeschnitten wird. Ihr Glück, denn nach dem Krieg braucht der deutsche Nachkriegsfilm „frische Gesichter“. Dass sie die Geliebte des viel älteren, verheirateten Tobis-Chefs und Goebbels-Vertrauten Ewald von Demandowsky war? „Ich hatte ihm nichts entgegenzusetzen“, schreibt sie achselzuckend. Dass die 19-Jährige sich mit dem überzeugten Faschisten und einem Trupp Wehrmachtssoldaten bei Kriegsende in die amerikanische Zone schlagen will, das Sturmgewehr im Anschlag, davon erzählt sie erst im „Geschenkten Gaul“. Lange bevor die Nazi-Verstrickungen deutscher Nachkriegs-Größen wie Henri Nannen (mit dem sie später, in ihrer „Piratenzeit“, eine Affäre haben wird) oder Günter Grass ans Licht kommen.
40 Seiten Krieg. Schlamm, Blut und Dreck, Todesangst. „Ich wollte nicht warten, bis die Russen kommen und mich vergewaltigen“, verteidigt sie diese Entscheidung, und erzählt dann, wie Irrsinn, Gewalt, Todesangst über sie herfallen. Nach Stunden nervenzerfetzender Stille rennt sie aus dem Bunker.
„Bei den Füßen fängt es an, das Zittern, das Schütteln schleicht rauf, den Körper rauf, rüttelt bis die Zähne klappern, bis mein Gesicht auf Grasbüschel, auf Steine schlägt, ich schluchze weine hemmungslos, will nicht mehr leben will nicht mehr warten auf ratatata. Sie zerren mich rein, sagen jaja is jut, so is det eben, ham wa alle hinter uns.“ Aber das Töten dauert noch Tage.
„Drüben wimmert’s, dann Bellen, trockenes Bellen aus Panzerkanonen. Ein Arm fliegt durch die Luft, Knochenarm, handloser Friedhofsarm, wir sehen ihm nach, der Alte zwischen uns stöhnt, bäumt sich auf, röchelt, gurgelt, ist tot“, so erinnert sie sich und vergisst auch die Feinde nicht. „Auf der Straße liegen die Russen, übereinander, nebeneinander mit verdrehten Beinen, verdrehten Köpfen. Sie rennen rüber, nehmen die MGs, reißen die Munitionsgurte ab, der Hitlerjunge krallt sich in unsere Jacken, jammert: Nehmt mich mit, nehmt mich doch mit.“
Demandowsky, dem sie so bedingungslos gefolgt ist, zeigt ihr den Punkt, hinten am Nacken, auf den man zielen muss, um sicher tot zu sein. Polnische Soldaten liefern sie den Russen aus. Ihre Rettung verdanke sie einem polnischen Lager-Arzt, erklärt Knef, sie habe ihn an seine von Deutschen getötete Tochter erinnert.
Demandowsky wird später erschossen, sie kommt frei – und beim unbescholtenen Ufa-Charmeur Viktor de Kowa unter. Nur noch Haut und Knochen, so leicht wie die Luft unter dem viel zu großen Männerjackett, so streunt sie durch die Ruinenlandschaften von Berlin, spielt Theater und trägt schon wieder Nagellack. Die Erstausgabe des Stern 1948 zeigt ihr junges Gesicht auf dem Cover, mit diesem unbeteiligten und dennoch lockenden, halben Lächeln.
1948 hat sie für „Film ohne Titel“ und ihre Rolle als Ruinenmädchen „Kat“ in Locarno den Preis als beste Darstellerin gewonnen, und bereits 1946 unter der Regie von Wolfgang Staudte „Die Mörder sind unter uns“ gedreht. Sie spielt darin ein Opfer des NS-Regimes, was nicht weiter thematisiert wird, bemuttert aber einen Mitläufer, der sich furchtbar leid tut wegen seiner deutschen Schuld.
Ein Reporter des Life Magazine schreibt 1947 ein begeistertes Feature über sie, und ein junger amerikanischer GI weicht ihr nicht mehr von der Seite. Der heißt Kurt Hirsch, spricht deutsch und ist im Sudetenland geboren. Für sie ist er ein netter Teddy, ein Junge, der über beide Ohren in sie verknallt ist. Bisschen dicklich, gar nicht ihr Typ, aber Mittel zum Zweck. Denn sie will raus. Was seine Eltern in New York sagen? Erst mal nichts, weil er es ihnen gar nicht erzählt. Wie sollte er das auch erklären, eine Deutsche heiraten – die Hirschs haben im Holocaust alles verloren, 17 Familienangehörige sind von den Deutschen ermordet worden.
Knef heiratet ihn, fliegt mit ihm nach New York, denn dort will man eine zweite Marlene aus ihr machen. Sie steht mit ihren Koffern in einem dunklen Flur, bockig vor dem Schrecken und Leid seiner Eltern, findet sie feindselig, kleinkariert, larmoyant. Erst viel später, da ist sie längst geschieden, begreift sie.
Eine zweite Marlene? Dazu ist sie „zu sehr Hilde“, keine Sphinx, kann sich nicht rar, nicht geheimnisvoll machen, muss immer mit allem herausplatzen. Die Meinung der anderen ist ihr nicht schnuppe. Sie leidet daran. „Kiek ma, det is doch die Knef“, sagt jemand in Tempelhof, als sie einen Tag nach dem Tod ihrer Mutter zurück nach Amerika fliegen muss, „n weißen Hut hat se uff, und dabei ist die Mutta jrade jestorbn.“
Trotzdem werden sie enge Freundinnen, die Dietrich und die junge Knef, die sich im „schicksten und finstersten Restaurant von Los Angeles“ begegnen: „Hallo“, hauchte es über die Hawaiigitarren hinweg. Das Gesicht, ein weißes Dreieck, verdrängte alles, machte alle anderen zum Hofstaat. Marlene öffnet ihr Türen, nur arbeiten darf Hilde nicht. Die Hollywoodbosse trauen ihr nicht über den Weg, zucken zurück, als der Name „Demandowsky“ fällt. „Man holte mich, man zahlte mir Geld, und ich saß dort rum, rannte gegen Gummiwände.“
Sie macht Probeaufnahmen und beschreibt eine Begegnung mit Filmmogul David O. Selznick als sexuellen Übergriff: Während Knef vor dem Schreibtisch sitzt, geht Selznick plötzlich ins Bad. „Ich hörte die Brause rauschen, hörte prusten und gurgeln. ‚Du bist ein interessantes Mädchen‘, sagte er und blieb vor mir stehen, ‚ein hübsches, interessantes Mädchen‘.“ Sein Lächeln war jenes, das Männer für einladend halten. „Magst du mich ein wenig?“, fragte er. Behäbiges Lächeln, Lächeln der Macht. Kann-mit-dir-machen-was-ich-will-Macht. Selznick reißt an ihrer Jacke … ein Knopf springt ab. „Der Mann, der nach Listerine und Rasierwasser roch, war bedrohlicher als die Russen, fremder als Marsmenschen, seine Rache unbekannt. ‚Mir ist schlecht‘, sagte ich, weil mir schlecht war, und rannte ins Bad …“
Daraufhin soll sie an die MGM „ausgeliehen“ werden, aber die Trümmermädchen-Rolle im Film „The Big Lift“ mit Montgomery Clift, ihre große Hollywood-Chance, bekommt eine andere.
„Komm Fritz, wir gehen!“ Das hört sie 1951, wieder zurück in Deutschland, oft. Für ein paar Sekunden war sie in Willi Forsts Film „Die Sünderin“ nackt zu sehen, dann schwenkt die Kamera schon wieder weg. Die Story: Ein Mädchen, das sich prostituiert, um ihrem Geliebten, einem Maler, die lebenswichtige Operation zu ermöglichen und die, als der Geliebte nicht mehr zu retten ist, mit ihm in den Tod geht. „Dämliches Melodram, Kitsch hoch drei“, wird sie später dazu sagen. Der Film wurde ein Skandal. „Empörte Bürger“ zogen vor den Kinosälen auf. Weil für einen Wimpernschlag ihre nackten Brüste zu sehen waren. Und weil sich Knefs Filmfigur Marina lieber umbrachte, als in einer Welt voll selbstgerechter Spießer weiterzuleben. „Dieser Film spottet nicht nur der christlichen Moral, sondern auch des elementarsten menschlichen Anstands, verhöhnt die Ehre unserer Frauen und Mädchen, gefährdet das gesunde Ehrbarkeitsgefühl unseres Volkes!“ steht auf den Flugblättern. „Der elementarste menschliche Anstand“, so so. Nach den Leichenbergen in den KZs. Nun also „Komm Fritz, wir gehen!“
Dann eben doch Amerika, wütet sie – nicht zum letzten Mal. Drüben spielt sie mit Gregory Peck und Tyrone Power, allerdings in Filmen ohne Belang. „Ich drehe mit bedeutenden Regisseuren unbedeutende Filme, die oft bedeutendes Geld einspielen, an dem ich nicht beteiligt bin.“ Und doch. Hildegarde Neff, wie sie in Amerika heißt, verewigt sich vor „Grauman’s Chinese Theatre“, wird 1952 in Hollywood zur „Schauspielerin mit dem größten Sex-Appeal“ gekürt.
Cole Porter erinnert sich, wie sie in „Schnee am Kilimandscharo“ seinen Song „You Do Something to Me“ singt, Sexappeal, der direkt in die Magengrube fährt. „The Neff“ und keine andere soll in seinem Musical „Silk Stockings“ die Ninotschka spielen. Die Handlung ist in etwa die des Films, den Ernst Lubitsch 1939 mit Greta Garbo gedreht hatte, „Ninotschka“. Die Geschichte einer Sowjetkommissarin, die in Paris die Liebe kennenlernt und ihrem kapitalistischen Verehrer verfällt. Nun als Musical am Broadway.
Ein Höllentrip für die Knef, Versagensängste fressen sie auf, wie soll sie den Vergleich mit der Garbo bestehen …? Aber sie sagt zu.
„Ich kann nicht schlafen. Aus Kopfkissen und Decke quillt die Musik. Ich höre mich Einsätze verpassen, sehe mich stolpern. Um halb sieben schlafe ich ein. Eine Stunde später ruft die Telefonistin: ‚„Du wolltest geweckt werden.‘“
Das also ist das Leben eines Broadway-Stars, drei Stunden und 40 Minuten auf der Bühne, 378 Vorstellungen in zwei Jahren. Einsamkeit und mörderische Disziplin, das, sagt Hildegard Knef, liege hinterm Rampenlicht. Die Produktion ist chaotisch, mehrmals wird das Skript geändert, sie bekommt die Masern und spielt trotzdem weiter … „To Hilde the Hun“, für „Hilde, die Hunnin“ schreibt das Team auf eine Karte nebst Blumenstrauß. Am Ende kommt Marlene „im schillernden Weißen“ zur Premiere, sagt „Lächle!“ und herzt sie vor allen Leuten. Der erste deutsche Broadway-Star!
„Aber plötzlich ist es mir gleichgültig“, erzählt sie. „Keine Freude, keine Aufregung. Stille, Leere, Müdigkeit.“ So geht es ihr oft. Wozu das alles? Das Musical soll verfilmt werden, sie ist für die Hauptrolle vorgesehen, wird aber von ihrer Produktionsfirma nicht freigegeben, über diesem Streit verlässt sie 1957 Amerika und kehrt nach Europa zurück.
In London fühlt sich der britische Nachwuchsschauspieler David Cameron herausgefordert, als er sie 1959 im Kino sieht, eine Zirkusreiterin, die sich die Männer selbst aussucht, völlig ungeniert. „That’s a woman and a half“, schwärmt er einem Freund vor. Cameron, sieben Jahre jünger, und die Diva werden ein Paar. Sie wünscht sich einen „starken Mann“. Optisch ist er es, der fast zwei Meter große Beau, der eigentlich Palastanga heißt und italienische Wurzeln hat. „Ich hätte Angst gehabt, einen deutschen Mann zu heiraten“, sagt sie einmal in einem Interview. „Die Männer meiner Jahrgänge sind alle noch damit beschäftigt, den verlorenen Krieg zu gewinnen, nachträglich, zu Haus, im Wohnzimmer.“ Cameron ist noch verheiratet. Und sie die Ehebrecherin. Nicht er. Monatelang geifern die Schlagzeilen, Filmangebote werden zurückgezogen. „Das einzige, was wir noch bekamen, waren Rechnungen und Briefe von Scheidungs- und Steueranwälten.“ Nach „dreijährigem Berufsverbot“ können sie 1962 endlich heiraten.
Mit 42 wird sie schwanger. Das Kind, ihre Tochter Christina Antonia, kommt sieben Wochen zu früh per Kaiserschnitt auf die Welt, Knef schwebt in Lebensgefahr: Durch die Bluttransfusionen infiziert sie sich mit Hepatitis, kann ihr Kind erst nach vier Wochen durch eine Glasscheibe sehen.
„Alles, alles, soll so bleiben, wie es ist“, strahlt sie in ihren Vierzigern. Und ihre ungeheuren, wüst schwarz getuschten Wimpern, die sie heben und senken kann wie einen Theatervorhang, streicheln ihre Wangen. „Die Mama soll die nicht aufsetzen, wenn ich Geburtstag habe“, wird ihre Tochter Christina später über diese Wimpern sagen. Es sei ihr peinlich vor den anderen Kindern. Deren Mütter trugen Schürzen, backten Kuchen. Und sie? Kämpft mit dem Bühnenleben, immer wieder halbtot vor Lampenfieber.
Irgendwie hat sie nie dazugehört. Nie ins Schema gepasst. Als „Ernährer“ hatte sich sowieso keiner angeboten, das erledigt sie selbst, aber das Geld zerrinnt ihr zwischen den Fingern. Sie beschuldigt ihre ManagerInnen, die deuten mit dem Finger auf sie zurück: alles ausgegeben, Gagen und Buch-Honorare großzügig verschleudert.
1973 wird ein kirschgroßes Karzinom in ihrer linken Brust festgestellt, das TV-Porträt „Knef 73“ zieht sie trotzdem durch; die unvorstellbaren Schmerzen wird sie in ihrem Buch „Das Urteil“ schildern und damit das Thema Krebs aus der gesellschaftlichen Tabuzone holen. Seit der Kindheit schleicht etwas Zerstörerisches in ihr herum, das sich immer neu verkleidet: als Typhus, Meningitis, rheumatisches Fieber, Nierenentzündung, schließlich als Krebs. Aber diese Entweder-oder-Krankheit gibt ihr den Mut, sich von Cameron zu trennen, der es satt hat, „Herr Knef“ zu sein und Fotoausrisse von vollbusigen Frauen in der Wohnung herumliegen lässt, die sie so kurz nach ihrer Brust-OP demütigen.
„Nach jahrelangem Ringen, Hoffen, Verzweifeln, Wahnwitz, pingeliger Streiterei, selbstmörderischem Kampf, wurde im österreichischem Wels Gerichtssaal 2, um zehn Uhr morgens, eine Hälfte von mir eingeäschert“, kommentiert sie ihre Scheidung.
„Denken schadet der Illusion“ hatte sie bereits im Lied „Eins und eins das macht zwei“ über das Verliebtsein thematisiert. 1971 macht sie in ihrem so harmlos auf Englisch daherplätschernden Song „Holiday Time“ eine Beobachtung: „…da stehen acht oder zehn Jungen in der Nähe der Standseilbahn. Sie sind gelangweilt. Sie sind so gelangweilt, dass sie anfangen, mit Steinen zu werfen. Sie zielen nah an die Beine und den Kopf der Mädchen. Acht oder zehn Jungs, die noch nie Krieg gesehen haben. Gesunde wohlhabende Jetset-Babys. Steine werfen sie, am dritten Morgen des Wassermann-Jahrtausends.“
Männer sind so – da macht sie sich keine Illusionen, aber sie wäre nicht die Knef, wenn sie nicht „neue Wunder“ erwarten würde. Ein Jahr nach der Scheidung von Cameron heiratet sie zum dritten Mal: Paul von Schell zu Bauschlott hatte ihren Umzug von Bayern nach Berlin organisiert und ist 15 Jahre jünger als sie, einer, der bei aller Sanftmut auch mal sagt: „Hildchen, wir müssen!“ Showmaster Peter Frankenfeld kalauert „der geschenkte Paul“ – und hat ganz recht damit. Ihr dritter Mann wird sie auch noch umsorgen, als sie nach Alkohol- und Drogenentzügen, hoch verschuldet und das Gesicht zur Maske operiert, in einer Berliner Erdgeschosswohnung im Rollstuhl sitzt.
Mit der Band Extrabreit hat sie in den kultseligen 90ern noch eine Version von „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ aufgenommen – und wird von Talkshow zu Talkshow gereicht. „Man muss versuchen, das Positive anzuziehen, nicht das Negative“, sagt sie zu Christoph Schlingensief. Es klingt müde.
Hinfallen und wieder aufstehen, wenn irgendwer, dann ist Knef die Symbolfigur für dieses Mantra. „16 Millimeter“, singt sie in ihrem letzten Song, fehlten ihr zum Gipfel. Wie Sisyphos. Man müsse sich Sisyphos „als einen glücklichen Menschen vorstellen“, hatte der französische Existenzialist Albert Camus geschrieben. War auch sie glücklich, zumindest ausgesöhnt mit der Welt? Dankbar für ihr pralles Leben, für all die Höhen und Tiefen, die sie in ihren Liedern so oft besang? „Wohl eher nicht“, sagte ihre Tochter Christina einige Zeit nach ihrem Tod am 1. Februar 2002. Kein Happy End also. Wäre ja sonst auch „Kitsch hoch drei“. Am 28. Dezember wäre die unsterbliche Hildegard Knef 100 geworden.
Ausgabe bestellen