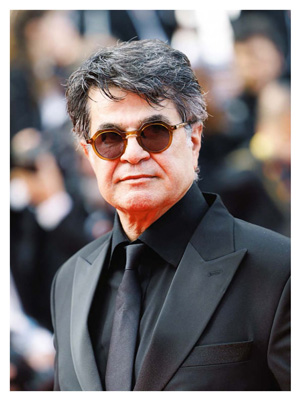Was gewonnen, was verloren?
Ich hatte ein Vaterland/das war mir mütterlich gesonnen/es schwankte immer am brüchigen Rand/hat alles verlorn und was schon gewonnen
Ich hatte ein Heimatland/da gab es Wärme und Nähe/und viel, das ich nicht sah oder nicht verstand/mein Herz wollt’, dass ich’s anders sähe
Ich hatte ein Vaterland/das verhieß mir friedliche Zeiten/es baute um sich eine schützende Wand/die wucherte in unsere Breiten
Heut wär’s einfach, nur das zu sehn/was schwer zu ertragen war/aber manchmal möchte ich mich umdrehn/und wieder nachhause gehn
Aus „Das Schöne an der Liebe“ anno 2000
Wär’ das Wetter schlecht gewesen, wäre ich nicht zum Rendezvous gegangen, als ich 16 war, und mehr Angst vor versauter Frisur hatte als vor vergeudeter Zeit.
Wäre ich nicht erst 18 gewesen, hätte mich die Gründung eines neuen deutschen Staates rings um mich sicher mehr umgetrieben als die Erkenntnis, dass ich von einem Mann geheiratet worden war, der mich so wenig verstand wie ich ihn.
Ich war eine gelangweilte junge Hausfrau, die sich durch die dickleibige internationale Romanliteratur las, oder Radio hörte, im Zimmer zur Untermiete am Rande Berlins. Ich war auch nicht dabei, und es scheuchte mich nicht auf, als viele Leute auf den Straßen ihre Unzufriedenheiten äußerten. Ich war keine Arbeiterin, mir waren keine Normen erhöht worden, es ging mich scheinbar nicht viel an. Im Mittelpunkt meines Interesses stand 1953, dass ich 22 war, und ausbrechen wollte, in mein eigenes Leben, mit Kind, ohne Geld, ohne Bleibe vorerst, aber mit viel Mut.
Es dauerte und gelang. Wenn keine Aufregung herausschaute, wäre ich nicht erschienen, mit 30, als mir ein ruhiger Tag wie eine vergeudete Chance vorkam. Ich wurde aber inzwischen unentwegt gerufen, in meinem kleinen Land, das sehr viele Talente brauchte, weil es unüblich viel und viele unterstützte, aber wieder verlor. Verlor an die Welt, die lockende und verlockende, an die Welt außerhalb dieser sowohl schützenden als auch mit zu vielen Plakaten und Losungen an Wänden und in Kantinen und sogar auf dem Friedhof mahnenden Vorschriften und Vorschlägen mit den großen Buchstaben.
Mit 30 habe ich jenem Urlaubstag im Sommer 1961, im idyllischen Petzow am Schwielowsee, höchstens an eine vorübergehende undurchdachte Maßnahme geglaubt, die vielleicht für Thüringen gelten sollte, doch nicht für Berlin. Wir waren vom Künstlerheim in Marika Rökks ehemaliger Villa zum Ortsausgang geschlendert, darunter mehrere sehr bekannte Künstler mit ihren Familien, hatten die Verfügungen im Zusammenhang mit dem „Antifaschistischen Schutzwall“, sprich Mauer, gelesen und nicht geglaubt. Die machen nächste Woche wieder auf, sagten auch Künstler, die im politischen Denken erfahrener waren als ich, eine Erstklässlerin auf diesem Gebiet. So naiv konnte ich nicht bleiben, denn ich wurde einbezogen und angefragt, immerzu, ab Dreißig. Ich sollte erscheinen, ich würde gebraucht, wie schmeichelhaft und fördernd.
Manchmal wurde aber gar nicht ich gebraucht, sondern nur jemand. Jemand ganz anderes, aber der war clever genug, Wichtigeres vorzuhaben, und also kam man auf mich zurück, von der bekannt war, sie könne so schlecht Nein sagen. Ich bin immer pünktlich eingetroffen, immer, aber die anderen kamen erwartungsvoll, wie aus der Arche zum letzten bei der Abfahrt vergessenen Vogel. Und da war dann nur ich, eifrig, übereifrig, und von solchen hatten sie schon genügend an Bord.
So waren wir einander enttäuschend und hielten uns gegenseitig auf, Wichtigeres zu erleben. Manchmal schade für mich, weil von den meisten Treffen etwas an mir hängen blieb, eine Aufgabe, eine Funktion, die besonders die Männer klug abzulehnen wussten. Zu sagen: Da komme ich nicht, brauchte es einen Mut, der erst wachsen musste.
Wäre ich nicht schon 40 gewesen, hätte ich ihn vielleicht nicht erkannt, den Gefährten, den Mann meines Lebens. Es war ein Anfang und es blieb alltägliche Arbeit – auch die, mit seinen Augen einen Teil der Zumutungen eher zu erkennen. Ebenso wie die Courage, sich beim Ansinnen von Mittäterschaft zu verweigern. Nicht immer gleich, manches war für beide schwer zu durchschauen. Ging es um den Sozialismus, um einen großartigen, mehr und mehr verpatzten Anfang, oder um das miese Rechthaben eines einzelnen Anmaßers?
Ich rede hier über mein Land, mein Zuhause, meine Verhältnisse, meinen alltäglichen Ärger, unseren Zorn. Und über die Unbildung bei „denen da oben“, die es in der Jugend nicht hatten erwerben können, nun aber auch keine Anstalten machten, etwas nachzuholen, auf Gebieten, in dem man sich auskennen muss, falls man über sie befinden soll. Sei es Landwirtschaft oder Kunst, man kann über alle Teile des Lebens falsch denken, wenn man sich Privilegien als Verdienste anrechnet. Es gab viel Ungutes, das ist wahr.
Aber es gab Menschen in meinem kleinen, schwierigen Vaterland, die waren wunderbar offen, die konnten lachen, sich wehren, die verstanden die Sprache der Kunst auch zwischen den Zeilen, die waren ihren Intellektuellen ganz nahe, holten sie sich, wenn sie mit ihnen reden wollten, gingen zu ihren Vorführungen und Arbeitsstätten, um zu genießen. Bezahlen konnten sie das immer. In meinem Land wurde das meiste „gestützt“, so dass wir viel zu billig aßen, fuhren, einkauften, telefonierten, Licht brennen ließen. Luxus war bei uns zu teuer, Alltägliches zu billig.
Ich kann mich nicht erinnern, jemals ohne Eile und Unruhe gewesen zu sein, aber ich finde kaum Angst in meinen Erinnerungen. Keine Angst um die nächste Mark, keine um das nächste Werk, auch um die Nächsten nur die normalen unerträglichen Sorgen und Ängste.
Wäre ich nicht schon Mitte 50 gewesen, hätte ich in jener lauten Novembernacht sicher meinen Mann geweckt, mir eine Pulle Schampus gegriffen und wäre der großen Neuigkeit in die Arme gerannt. Es war eine so schöne Nacht. Es schien, als fände ein jedes seine Musik und seinen neuen Freund. Und die Italiener, Griechen, Jugoslawen, Türken, sie haben sich so mit uns gefreut, gehörten fast dazu. Von meiner Haustür bis zum Check Point Charly waren es nur hundert Meter, und von meinem Balkon im 25. Stock aus konnte ich alles beobachten.
Mir schien, dass ich niemanden sehen konnte, der auf dieses Ereignis gut genug vorbereitet war. Nicht die Leute im Trabi, nicht die Politiker, auch nicht jenes Häuflein, das seither in Anspruch nimmt, es habe mit seinem Anteil den wesentlichen Teil geleistet. Mit den geheimen Kontakten und der offenen Aufmüpfigkeit sei die Mauer geschleift worden. Vielleicht hätte ich ihnen das geglaubt, aber ich habe sie anschließend nicht so klug, nicht so bedächtig handeln sehen, wie es nötig gewesen wäre, um Weltgeschichte zu machen.
Sie verschwanden in lukrativen Posten, von denen aus sie unser aller Leben von „vorher“ zum Dreh- und Angelpunkt jedes künftigen Planes machen wollten. Es ging ihnen sehr gut, aber sie wurden unwichtig. Wenn sie es bemerkten, fütterten sie die Zeitungen wieder mit Details aus ihrem Leben als Opfer.
Und die Leute? Die verloren erst einmal den Kopf: Bananen, überteuerte Kaffeefahrten zwecks Erwerbs von falschen Lamadecken, oder unechten Silberbestecks. Eine Zeit auch echter Freude beim Wiedersehen, zunächst, oft nicht von langer Dauer.
Die DDR war weit offen wie Rudis Reste-Rampe, und ein bestimmter weit gefasster Personenkreis konnte sich so lange beidhändig bedienen, bis die Ausplünderung schlimme Folgen zeitigte. Sie fing an zu kosten und hört nicht auf damit.
In der DDR war ich bekannt für lautes Eingreifen bei Ungerechtigkeit. Meistens hatte ich es dabei mit Männern zu tun, die mächtiger waren als ich, die nur Einfluss hatten, keine Macht. Hätte mich auch nur einer gefragt: Und was geht dich die Sache an?, dann hätte ich dumm dagestanden. Aber ich bin das nie gefragt worden und nehme an, dass die Männer jeweils dachten, hinter mir stünden noch viel mächtigere Männer, wahrscheinlich die Rote Armee.
Ich war 60, als ich Mitglied im einzigen Frauenverband aus der DDR wurde, ein paar Monate später deren Vorsitzende und seit acht Jahren bin ich nach vergeblichem Versuch, mich auf mein Alter zu berufen, Ehrenvorsitzende, mit nach wie vor lebendigen, liebevollen Beziehungen zu den Frauen in den „neuen“ Bundesländern. Warum habe ich das gemacht, mich auf Kämpfe mit der Treuhand, mit Gemeinden, Räten und Beamteten eingelassen, warum?
Nun, die zweite Zuversicht im Leben erwächst aus der Erfahrung. Es ist nicht wahr, dass man nichts tun kann.
Andere sehen das anders. Andere treten mit Bildung ins erwachsene Leben ein, andere werden als Kind geliebt und also ermutigt, andere nehmen sich gleich den richtigen Mann und können es dabei belassen – aber andere haben vielleicht auch nicht diesen lebenslänglichen Hunger, aus soviel miesem Anfang, soviel Nachkrieg, Fehlleitung, Unterdrückung und Irrtum des Herzens etwas zu machen, mit dem es sich leben lässt. In der Hoffnung, es lässt sich mit mir leben. Diese Frage zu stellen, werde ich mich mit 80 Jahren trauen. Frühestens. Falls.
Gisela Steineckert war Initiatorin der „Singebewegung“, Präsidentin des „Komitees für Unterhaltungskunst“ (1984–1990) und ist heute Vorsitzende des „Demokratischen Frauenbundes“. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Liebesgedichte“ (Neues Leben).