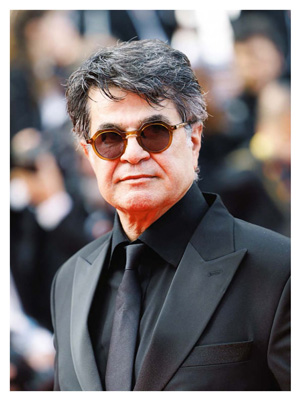Frauen machen es nur falsch!
Sie schreiben in Ihrem Buch, Corona lasse „die wahren gesellschaftlichen Verhältnisse wie unter einem Brennglas hervortreten“. Welche Verhältnisse meinen Sie?
Wir hatten schon vor Corona überall Lücken zwischen Männern und Frauen: Lücken bei der bezahlten Arbeit pro Stunde oder beim Lebenseinkommen, also den Gender Pay Gap; Lücken bei der Rente, also den Gender Pension Gap; und natürlich Lücken bei der unbezahlten Arbeit, also den Gender Care Gap. Und jetzt kommt Corona und trifft auf Haushalte, in denen Frauen, wenn sie Mütter sind, zum größten Teil in Teilzeit arbeiten und Männer in Vollzeit. Das heißt natürlich, dass Frauen in der Corona-Pandemie von Anfang an die schlechteren Karten hatten, weil sie sowieso schon den halben Tag zu Hause waren, um die ganze Sorgearbeit zu leisten und nun angenommen wurde, dass diese Frauen jetzt ganztags auf die Kinder aufpassen. Deshalb hat man es auch nicht für nötig befunden, eine gesellschaftliche Debatte darüber zu führen, was die Schließungen von Schulen und Kitas für die Frauen bedeutet. In anderen Ländern wie Frankreich oder Schweden wäre das überhaupt nicht denkbar!
Die Frauenministerin war ja auch nicht im sogenannten „Corona-Kabinett“.
Genau. Wir haben in Deutschland noch immer eine Kultur der AnderthalbErwerbstätigen-Familie mit der Frau, die in Krisen wie der Corona-Pandemie alles auffangen soll.
Sie beginnen Ihr Buch mit Ihrer persönlichen Familiengeschichte. Ihre Großmutter, geboren 1900, hat einen Laden und ist ihr Leben lang berufstätig. Ihre Mutter studiert Ökonomie, bricht aber das Studium ab, als das erste Kind unterwegs ist. Als sie 45 ist und drei Kinder hat, stirbt Ihr Vater an einem Herzinfarkt. Welche Konsequenzen haben Sie daraus für Ihr Leben gezogen?
Ich habe erstens gesehen, dass meine Mutter im Alter plötzlich ohne finanziellen Schutz dastand, weil mein Vater das Haus unter anderem mit seiner ausgezahlten Rentenversicherung bezahlt hatte. Sie bekam deshalb keine Witwenrente. Zweitens habe ich festgestellt, dass eine Frau, die mit 45 wieder an die Universität geht, wie meine Mutter es dann tat, es verdammt schwer hat. Daher kam für mich überhaupt nicht in Frage, meine Berufstätigkeit für längere Zeit zu unterbrechen und mich von Männern abhängig zu machen. Ich wollte in allen denkbaren Notfällen von meinen eigenen Einkünften leben können.
Sie haben dann Ihren Sohn erst mit 38 bekommen. Sie hatten an der Universität München gerade ihre erste Professur angetreten.
Der Vater meines Kindes war Professor in Bremen und rechnete mir vor: „Wenn du aussetzt, sparen wir die teure Kinderkrippe, die Nanny, die Wohnung in München und die Zugfahrten!“ Dass er aufhören könnte zu arbeiten, war außerhalb jeder Diskussion! Er war sieben Jahre älter als ich und hatte seine Professur schon etliche Jahre. Aber das ist ja keine ganz untypische Situation. Es gibt viele Paare, bei denen die Männer einen Altersvorsprung haben und nicht mehr am Anfang ihrer Karriere stehen.
Sie sind dann einige Wochen nach der Geburt Ihres Sohnes wieder eingestiegen.
Mein Kind kam im Januar zur Welt und ich dachte: Wenn ich Ende Februar wieder unterrichte, dann verlieren die Studierenden kein Semester. Ich glaubte also, dass ich allen etwas Gutes tue, wenn ich schnell wieder in die Arbeit einsteige. Ich stieß aber auf gewaltiges Unverständnis, vor allem auch bei meinen Studierenden. Damit hatte ich nicht gerechnet – ich war wirklich baff. An dieser Erwartung an Mütter, dass sie im ersten Jahr nach der Geburt bitte komplett beim Kind sein sollen, hat sich leider bis heute nicht viel geändert.
Und wie haben Sie Kind und Beruf organisiert?
Ich habe meine Lehrveranstaltungen in München immer dienstags bis donnerstags abgehalten. Als ich noch stillte, betreute meine Mutter meinen Sohn an diesen Tagen. Später gab es die Kinderkrippe und eine Kinderfrau. Mein Kind war dann von Dienstag bis Donnerstag beim Vater und zurück aus München war ich von Freitag bis Sonntag die Lieblingsmutter (lacht).
Hatten Sie ein schlechtes Gewissen?
Nein! Aber das lag daran, dass ich vorher sieben Jahre in den USA studiert hatte und dort, was das Mutterbild anbelangt, in einem ganz anderen Kulturkreis war. Ohne die Zeit in den USA hätte ich mich womöglich anders entschieden. Außerdem ging es meinem Kind bombig.
Seit 2007 haben wir die Elternzeit: Ein Jahr plus zwei Partnermonate, die bezeichnenderweise „Vätermonate“ genannt werden. Schlägt die Elternzeit auf die Mütter zurück?
Die zwei Partnermonate wären in Ordnung – wenn sie kein Geschlecht hätten. Sie haben aber eins: 90 Prozent der Mütter nehmen Elternzeit, aber nur 37 Prozent der Väter. Und von denen wiederum nehmen 72 Prozent nur zwei Monate. Deshalb bin ich dafür, die Partnermonate wenigstens auf vier von insgesamt 14 zu erhöhen. Ich bin sicher, dass das funktionieren würde.
Stichwort Teilzeit. Zwar sind immer mehr Frauen berufstätig, nämlich aktuell fast drei von vier, aber die Teilzeitquote ist gestiegen: von 30 Prozent im Jahr 1991 auf 46 Prozent 2018.
Wir können noch weiter zurück gehen: Als meine Großeltern den Laden aufmachten, also 1925, war nur die Hälfte der Frauen berufstätig, das aber fast immer in Vollzeit. Das heißt: Früher konnten Frauen von ihrer Berufsarbeit leben, auch im Alter. Das ist mit Teilzeitarbeit nicht möglich. Hinzu kommt die sogenannte Teilzeit-Strafe: Erstens ist der Stundenlohn bei Teilzeit-Beschäftigten oft niedriger als ein VollzeitStundenlohn. Zweitens zeigen Statistiken, dass man aus Teilzeit heraus sehr viel schlechter in höhere und damit besser bezahlte Positionen aufsteigen kann. Insofern ist Teilzeit nicht für eine eigenständige Existenzsicherung geeignet. Wenn Männer wie Frauen Teilzeit arbeiten würden, dann würden für die Teilzeit ganz andere Möglichkeiten geschaffen: Zwei Leute würden sich zum Beispiel eine Führungsposition teilen.
Nun wird ja immer gern behauptet: Frauen wollen das so. Sie wollen für ihre Kinder sorgen, sie wollen gar nicht in Führungspositionen.
Das stelle ich prinzipiell in Frage. Denn Frauen müssten ja Optionen haben, es anders zu machen, und diese Möglichkeiten sind nicht da. Wir haben zu wenige Ganztagsschulen, wir haben kaum Kitas mit flexiblen Betreuungszeiten, wir haben keine ausreichende Ferien-Betreuung. Stattdessen setzt unser Steuer- und Sozialsystem ganz starke Anreize für Frauen, Teilzeit zu arbeiten. Allen voran natürlich das Ehegattensplittung, aber auch die kostenlose Mitversicherung bei der Krankenkasse. Ich finde es deshalb zynisch und arrogant, Frauen vorzuwerfen, dass sie nicht Vollzeit arbeiten wollen, wenn die Rahmenbedingungen überhaupt nicht danach ausgerichtet sind.
Das Ehegattensplitting scheint eine Heilige Kuh zu sein. Keine Regierung hat es bisher abgeschafft.
Ich sehe nicht ein, dass man zwei kinderlose Erwachsene einfach aufgrund ihrer Ehe steuerlich belohnen sollte. Stattdessen könnten wir zwei Wege gehen: Wir machen ein Familiensplitting, wie es Österreich schon 2009 eingeführt hat. Da ist die steuerliche Förderung an Kinder gebunden. Oder wir führen eine Individualbesteuerung ein, wie es sie in skandinavischen Ländern schon sehr lange gibt.
Zu diesen strukturellen Gründen, die in Deutschland gegen die Berufstätigkeit der Frau arbeiten, gibt es, schreiben Sie, auch die kulturellen Gründe. Stichwort Rabenmutter.
In Deutschland gehören die Kinder immer noch zu den Müttern. Mütter, die schnell in den Beruf zurückgehen, werden hierzulande stigmatisiert. Meine Mitarbeiterin Lena Hepp hat das nachgewiesen. Sie hat auf Stellenanzeigen fiktive Bewerbungen verschickt und dabei zwei Parameter verändert: Einmal hat sich ein Mann beworben, einmal eine Frau. Beide haben im einen Fall zwei Monate Elternzeit genommen, im anderen Fall zehn. Das Resultat: Bei den Männern machte es keinen Unterschied, wie lange Elternzeit sie genommen hatten. Bei den Frauen aber wurden diejenigen, die zehn Monate unterbrochen haben, eher zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen als diejenigen, die nur zwei Monate ausgesetzt hatten. Als wir die Arbeitgeber nach den Gründen gefragt haben, wurden diese Frauen als „überambitioniert“ und „unangenehm“ bezeichnet. „Rabenmütter“ eben.
Das heißt, Frauen können es eigentlich nur falsch machen?
Genau das ist das Problem. Wenn sie zu lang aussteigen, kommen sie im Beruf nicht richtig weiter. Wenn sie zu kurz aussteigen, wird ihnen das auch übel genommen.
Sie haben die Initiative „Ich will!“ mitinitiiert, die sich für eine Frauenquote in Vorständen einsetzt. Die kommt aber nur ein paar wenigen, extrem gutverdienenden Frauen zugute.
Ich halte es trotzdem für wichtig, dass Frauen in den Vorständen vertreten sind. Wenn Sie mit Kindern sprechen, und sie nach dem Bundeskanzler fragen, dann sagen die: Das ist ne Frau! Das ist Frau Merkel! Da sieht man doch, dass eine einzige Frau formen kann, was junge Mädchen sich als erreichbar beziehungsweise unerreichbar vorstellen. Von daher finde ich es total wichtig, dass diese Vorstandsfrauen sichtbar sind.
Kommen wir nochmal zu Corona: Sie haben bei Anne Will von einer „entsetzlichen Retraditionalisierung“ durch Corona gesprochen. Eine Studie des Familienministeriums hat ergeben, dass immerhin 20 Prozent der Väter jetzt mehr Familienarbeit übernehmen als vorher. Ist das nicht ein Fortschritt?
Es sollte uns immer froh stimmen, wenn Männer mehr Familienarbeit übernehmen. Nur bitte ich darum, dass wir hier nicht übermütig werden. Erstens wird ja proportional gerechnet. Das heißt: Wenn ein Mann von null Stunden auf zwei Stunden erhöht, dann ist das prozentual ein viel höherer Zuwachs als wenn eine Frau von sieben auf acht Stunden erhöht. Außerdem geht es bei der Sorgearbeit ja oft um Verantwortung, Planung und Organisation. Die kann man schlecht in Stunden messen. Wer liegt nachts wach und überlegt, ob alles läuft? Eine neue Studie der TU Chemnitz zu diesem sogenannten „mental load“ belegt: Das sind wesentlich öfter die Mütter.
Arbeitsminister Hubertus Heil plant ein gesetzliches Recht auf Homeoffice. Was halten Sie davon?
Natürlich ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Homeoffice leichter. Ich sehe allerdings überhaupt nicht, dass das Homeoffice die großen Lücken, die wir haben – beim Gender Care Gap, Gender Pay Gap, Gender Position Gap, Gender Pension Gap – irgendwie schließen könnte. Im Gegenteil. Die Unterschiede werden eher größer als kleiner. Wir sehen, dass Frauen im Homeoffice sehr viel mehr mit den Kindern jonglieren als Männer im Homeoffice. Die einzige Konstellation, in der das anders ist: Wenn die Frau in einem systemrelevanten Job vor Ort arbeitet und der Mann im Homeoffice ist. Dann reduzieren sich die Unterschiede. Das ist aber nur in zwölf Prozent der Familien der Fall. Wenn man also das Recht auf Homeoffice einführt, käme es zum einen auf die Zeiten an: Ein Tag pro Woche ist was anderes als die ganze Woche. Und man müsste sicherstellen, dass Männer das Recht auf Homeoffice genauso in Anspruch nehmen wie Frauen. Frauen haben sich jetzt seit Jahrzehnten bemüht, aus der Familie raus ein eigenes öffentliches Leben zu führen. Die Erfolge dürfen wir nicht aufs Spiel setzen.
Sie sprechen auch von einer „Refeudalisierung“ der Gesellschaft durch Corona. Was heißt das?
In einem Feudalsystem kann man den Stand, in den man hineingeboren wurde, nicht verlassen. Und wir sehen gerade, dass Kinder, die aus finanziell schlechter gestellten Familien kommen, oft nicht die Computer haben, die sie bräuchten, um beim digitalen Unterricht mitzumachen. Sie sind oft in Schulen, die da nicht ausreichend Angebote machen. Sie haben auch viel zu wenig Platz, kein Zimmer und keinen Schreibtisch, und auch keine Eltern, die quasi zu Ersatz-Lehrern werden. Das sind Rahmenbedingungen, für die das einzelne Kind nichts kann. Die soziale Spaltung, die in Deutschland sowieso schon extrem groß ist, vergrößert sich also weiter. Ich sage immer: Mein Sohn hatte pränatal Abitur. Er war kein guter Schüler, aber da wurde immer gesagt: Der kommt aus einem Zwei-Professoren-Haus, der wird das schon schaffen! Und natürlich hat er es geschafft, er ist heute Mediziner.
Hat diese Refeudalisierung auch einen Geschlechteraspekt?
Ja. Wenn wir zum Beispiel auf die Alleinerziehenden schauen, von denen ein Drittel armutsgefährdet sind. Und viele Frauen, mit denen ich rede, finden es erniedrigend und entwürdigend, wenn sie ihren Kindern sagen müssen: Es tut mir leid, ich kann dir den Computer nicht kaufen. Oder: Ich kann dir bei den Hausaufgaben nicht helfen.
In Ihrem Buch stellen Sie sich vor, was passieren muss, damit Ihre fiktive Enkeltochter Marie ein freies Leben als berufstätige Frau führen kann.
Mein Wunsch ist, dass junge Frauen und Männer das, was sie sich wünschen, bevor sie Kinder bekommen – nämlich eine partnerschaftliche Aufgabenteilung – auch realisieren. Das heißt, dass sie sich die unbezahlte Familienarbeit und die bezahlte Erwerbsarbeit gleich aufteilen. Deshalb plädiere ich für die 32-Stunden-Woche als neues Normal für Frauen und Männer, die Eltern von Kleinkindern sind. Und alle Anreize für eine ungleiche Arbeitsverteilung zwischen den Geschlechtern müssen weg!
Das Gespräch führte Chantal Louis.
WEITERLESEN: Jutta Allmendinger: „Es geht nur gemeinsam“ (Ullstein)