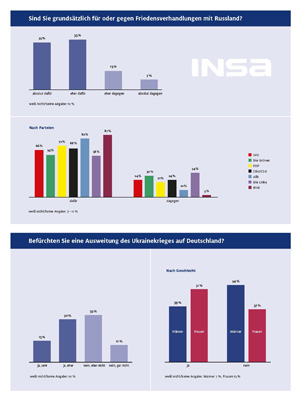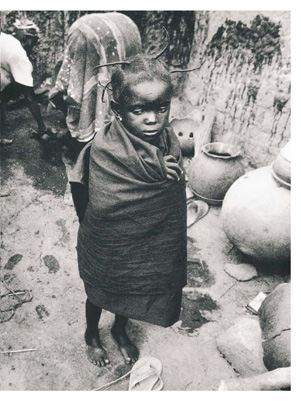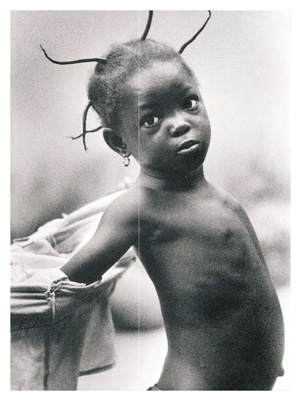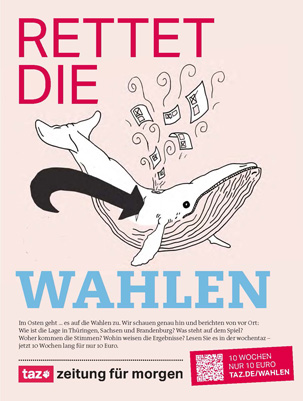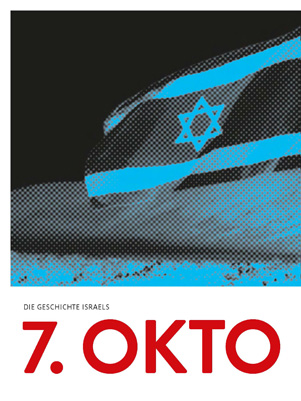Wie der Machismo den Krieg gebiert
16. Juli 1999. Der Tag ist heiß und staubig. Wir sind im Bergland, im Norden Albaniens, am Grenzübergang nach Kosovo, schwer bepackt mit Kameras und Mikrophonen, Wasserflaschen und Proviant. Etwa 300 Reporterinnen und Reporter ziehen mit den Wagen der ersten Nato-Einheit über die Grenze. Drüben im Kosovo sollte jetzt Frieden sein. Keine Militärs mehr, keine Paramilitärs, keine Minen. Quadratische Gruben im Asphalt der Straße zeugen davon, dass wir die verminte Allee jenseits der Grenze betreten können – serbische Einheiten haben die Minen ausgegraben.
Aber die Militärs und Paramilitärs, die sind noch da, anders als vertraglich vereinbart. Auf einer Zufahrtsstraße nach Prizren, der nächsten Kleinstadt, begegnen sie uns. Am Ende der menschenleeren Straße haben sie einen Checkpoint aufgebaut. Zwei Männer um Mitte 20 blockieren die Straßenmitte, breitbeinig, kahl geschoren, in schwarzen T-Shirts und dunklen Hosen im Military-Style, Maschinenpistolen im Anschlag. Rechts und links der Straße haben sich zwei weitere aufgebaut, vor den Brettern eines leeren Kiosks, die Läufe der Waffen auf ein Holzgestell gestützt. Es ist still auf der Straße, als wir ihnen zu dritt alleine entgegenkommen, ein Argentinier, zwei Deutsche.
„Get out“ brüllt der Mann in der Mitte, als wir näher kommen. Wir gehen langsamer. „This is Serbia! Get out!“ Wir treten vor sie, tun harmlos. Auf dem schwarzen T-Shirt des Checkpoint-Chefs prangt weiß das Wort „underground“. Die Männer, denen wir hier begegnen, vibrieren vor Aggression und Kraft. Sie scheinen bereit, auf alles zu schießen, was ihnen über den Weg läuft. Es ist der Tag der Kapitulation, sie haben nichts mehr zu verlieren.
Diese Männer würden nicht zum ersten Mal schießen. Wir sind hier die Herren, Herrscher, Helden. Keiner entkommt uns. Diese hier waren anders, als die fast schüchtern wirkenden Soldaten der serbischen Armee entlang der Allee von der Grenze in die Stadt, die trotzig das Victory-Zeichen machten und auf den Heimweg gefasst waren. Der Code dieser Männer am Checkpoint lautete, dass sie keine Gesetze anerkennen, dass Brutalität ihr Herrenrecht ist, überall. Das war mehr als die weltweit übliche Polizei-Gewalt oder die von Türstehern auf St. Pauli. Es war eine Gewalt ohne Grenzen, eine Haltung, auf die niemand vorbereitet sein kann.
Sie verlangten unsere Pässe. Wir sprachen mit ihnen freundlich, ruhig wie in Trance, instinktiv bemüht, die Gefahr zu ignorieren. Sie ließen uns gehen. Ich weiß bis heute nicht warum. Am selben Tag wurden, ein paar Stunden später und wenige Kilometer entfernt, zwei Stern-Reporter erschossen.
Der Checkpoint war meine erste Begegnung mit den Paramilitärs, von denen die Flüchtlinge aus dem Kosovo immer wieder berichtet hatten. Kleinkinder im Flüchtlingslager, die lange Objektive auf sich gerichtet sahen, und schrien, weil sie sie für Waffen hielten. Frauen hatten nicht mehr weitersprechen können, Männer sich weinend weggedreht, wenn die Familie erzählte.
Die Männer am Checkpoint, sagten Bewohner von Prizren uns später, sollen Leute wie die „Arkan-Tiger“ oder die „Frenki-Boys“ gewesen sein, Mitglieder paramilitärischer Einheiten, die in allen Zerfallskriegen Jugoslawiens eine zentrale Rolle spielten: Als Träger des Terrors, Paramilitärs, die mit der regulären Armee kooperierten. Morde, Brände, Plünderungen und Vergewaltigungen gehörten zentral zum System der nach-titoistischen Herrschaft Ex-Jugoslawiens.
Gegen „Arkan“, den Kopf der „Arkan-Tiger“, bürgerlich Zeljko Raznatovic, hatte die Den Haager Chefanklägerin Louise Arbour Anklage erhoben. Doch ehe der Mann gefasst werden konnte, wurde er im Belgrader Intercontinental-Hotel am 15. Januar 2000 erschossen. „Arkan“ war zu Lebzeiten kein „serbischer Held“. Heute ist er ein Mythos. Der Lebemann und Unterweltboss hatte 1995 die populäre Turbo-Folksängerin Ceca geheiratet, seine Pop-Prinzessin. Der Held und seine Braut sind exemplarisch für das Verhältnis der Geschlechter in der serbischen Nachkriegsgesellschaft: die Folkloresängerin und Nationalistin und der zum Warlord avancierte Söldner.
Als Ceca, Arkans schöne Witwe, zwei Jahre später im Juni 2002 in Belgrad im Marakana-Stadion vor über 100.000 ZuschauerInnen auftrat, besang sie ihren Helden. Und das Publikum, Männer wie Frauen, skandierte hingerissen: „Ar-kan! Ar-kan!“
Gleichzeitig vegetieren in Serbiens Psychiatrien heute viele junge Männer mit schweren seelischen Problemen – die vor allem auf das Nato-Bomben-Trauma zurückgeführt werden. Doch: „Das ist eine Verschiebung“, protestiert die in Berlin lebende serbische Exilantin Dragana. „Diese Männer wissen alle, was sie während der Kriege als Soldaten getan haben – das nimmt ihnen die Seelenruhe.“
Zwar sind die Kriege vorüber und wächst langsam die Demokratie, doch die Heldenmythen stehen noch immer dem Fortschritt entgegen, der mit einer Katharsis beginnen müsste: Mit dem Erinnern und Anerkennen des Geschehenen. In nahezu allen Teilen Ex-Jugoslawiens fürchten sich Regierung wie Bevölkerung davor, dass „ihre Leute“ ans Haager Tribunal überstellt werden könnten, genauer gesagt: ihre Männer. Als einzige prominente Frau stand bisher die bosnische Serbin Biljana Plavsic, einst Stellvertreterin von Staatspräsident Radovan Karadzic, vor dem Tribunal – und bekannte sich schuldig im Sinne der Anklage. Für die kroatische Autorin Slavenka Drakulic ist Plavsics Geständnis, zu Rassenhass und Gewalt beigetragen zu haben, „ein Lichtstrahl der Hoffnung“. Wenigstens Einsicht und Schuldbewusstsein hat diese Täterin …
Das ist nicht typisch. In Kroatien wie in Serbien, und nicht minder in Bosnien und unter Kosovo-Albanern, werden die männlichen Kriegshelden noch immer gefeiert. „Keine Kriegsverbrecher, sondern Helden!“ plakatierten Kroaten für ihre von Haag gesuchten Generäle Bobetko und Gotovina. Deren Abbilder kleben an zahllosen Windschutzscheiben und Gartenmauern. Auch die bosnischen Serben Radovan Karadzic und Ratko Mladic, beide vom Menschenrechts-Tribunal als mutmaßliche Hauptverantwortliche für den Völkermord in Bosnien gesucht, werden seit Jahren von der lokalen Bevölkerung ebenso wie von der Elite ihres Landes geschützt, in der ländlichen Republika Srpska wie in der Hauptstadt Belgrad. Und nicht minder zwielichtig ist die Rolle der in Albanien als Helden verehrten Brüder Agim und Lek Ceku, UCK-Bosse, denen vom Haager Tribunal – und den UN-Gerichten im Kosovo – Untaten zur Last gelegt werden.
Urplötzlich schien all das Grauen Anfang der 90er über das Land zu fallen, doch nichts, was in den Ländern Jugoslawiens geschah, fiel vom Himmel. Die Mythen, die Männerbilder und Frauenbilder kommen von weit her, aus der Tiefe der Geschichte des Balkans. Alida Bremer, in Gießen lehrende Literaturwissenschaftlerin aus Kroatien, erforscht seit Jahren den fatalen Zusammenhang zwischen Nationalismus und Männlichkeitswahn in (nicht nur) Ex-Jugoslawien. Ihre Wander-Ausstellung vom „Untergang der Helden“, die zuletzt im Berliner Südosteuropa-Kulturzentrum zu sehen war, zeigt bildhaft, was sie sagt: „Alle Forscher sind sich einig, dass innerhalb des Balkans der folkloristisch-populistische Heldenmythos am virulentesten in Serbien ausgeprägt ist.“ Und es ist kein Zufall, dass „allen Nationalisten unter den Südslaven sowie den Albanern die Geschlechterhierarchie wichtig ist. Ihr Freund-Feind-Denken – wir und die Anderen – gilt auch für die Geschlechter: Wir Männer und die Anderen (Frauen).“
Ein erster Emanzipationsschub wurde von dem Widerstand gegen die Nazi-Okkupation ausgelöst. Die „antifaschistische Frauenfront“ der kommunistischen Partei rief die Frauen auf zu kämpfen. Rund 100.000 Partisaninnen folgten, von denen 25.000 im Einsatz fielen. Von ihrem Ruhm ist selten die Rede (ganz wie bei den 1.000.000 Soldatinnen der Roten Armee). Nur der Autor Bato Tomasevic setzt seiner älteren Schwester, der berühmten Partisanin Stana Tomasevic, ein Denkmal. In seinem Buch „Montenegro. Eine Familiensaga im Jahrhundert der Konflikte“ beschreibt er ausführlich ihr Leben. Doch die Mehrzahl der Frauen bekam weder ein Denkmal, noch wurde ihrer auch nur gedacht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Frau wieder Mutter zu sein, Trösterin und Hüterin des Herdes. „Nur noch Feministinnen erinnern heute an die Frauenopfer des Zweiten Weltkrieges“, stellt Alida Bremer trocken fest. Eine der wichtigsten kroatischen Feministinnen, die verstorbene Lydia Sklevicky, hinterließ zahlreiche Schriften zu diesem Thema. Dunja Rihtman Augustin hat sie in „Konji, zene, ratovi“ (Pferde, Frauen, Kriege) herausgegeben, das in Zagreb in der Reihe der „Zenska infoteka“, Frauen-Infothek, erschien. Zenska infoteka gibt auch die feministische Zeitschrift „Brot und Rosen“ heraus, eine Art EMMA auf kroatisch.
Doch Feministinnen, die fassen in den Ländern Südosteuropas nur ganz allmählich Fuß, obwohl sie die Erbinnen Titos sind. An einem Berghang oberhalb des montenegrinischen Podgorica, einer Station auf der Route der Mädchenhändler zwischen Rumänien und Italien, öffnete 2002 erstmals ein Frauenhaus seine Tore, um geflüchteten Mädchen Schutz zu bieten.
Es stimmt: Das Gesetz gewährte Frauen im Jugoslawien von Titos „Drittem Weg“ auch innerhalb des Ostblocks eine besonders große Bewegungsfreiheit und Chancengleichheit: Sie konnten Ingenieurinnen werden oder Ärztinnen, Traktoristinnen oder Lehrerinnen, Akademikerinnen und sogar Geschäftsfrauen. Doch nach den Sitten gehörten Frauen weiterhin „an den heimischen Herd“, und die meisten mussten bald beide Aufgaben schultern: Verdienen und Dienen. Verschärft wurden die traditionellen Fesseln dadurch, dass die Familie in „balkanischen“ Gesellschaften (wo es lange Epochen der Fremdherrschaft, der wiederkehrenden Schlachten, Scharmützel, Rivalitäten gab) traditionell das Herz der Gesellschaft war.
Unter Milosevic erlebte die nationalistische Rhetorik nach Tito dann eine aggressive Renaissance. Der Staatschef selber inszenierte sich am 28. Juni 1989 auf dem Amselfeld in Kosovo quasi als Reinkarnation des dort am 28. Juni 1389 gefallenen serbischen Prinzen Lazar, indem er sich per Helikopter – aus dem Himmel – auf das alte Schlachtfeld niedersenken ließ. Die Gebeine des Toten von damals ließ er exhumieren: Von Dorf zu Dorf zog der alte Leichnam und löste regelrechte religiöse Hysterien aus, vor allem auch Frauen ließen sich wieder taufen. Die orthodoxe Kirche und die nationalistischen Politiker machten gemeinsame Sache. „Der Krieg hat das positive, emanzipatorische Erbe des Sozialismus weitgehend vernichtet“, bedauert Alida Bremer. „‚imati muda‘, also ‚Eier haben‘, Mut, Entschlossenheit, Intelligenz, Kompetenz, wurde auch in den Medien und privat immer häufiger zur Charakterisierung von Soldaten verwendet.“
Untrennbar mit dem Männlichkeitswahn verbunden ist auch hier der Nationalismus. Die zur Zeit in den USA lebende kroatische Soziologin Vesna Kesic: „In kriegerischen Auseinandersetzungen wird der Körper der Frau gleichgesetzt mit dem ethnischen Korpus und dem Staat. Identität, die in einer ethnischen Identität aufgeht. Die Frau ist an sich ‚die Fremde‘, kann und muss aber Teil der nationalen Konstruktion werden. Konsequenz: Die Frau und ihre Fähigkeit zu gebären müssen unter Kontrolle gebracht werden.“
Berichte aus den serbischen Vergewaltigungslagern belegen, dass es Teil der Fantasien der Täter war, ihre weiblichen bosnischen Opfer würden ihnen „serbische Söhne“ gebären – eine besondere Schmach für den besiegten Mann. Der männliche Imperativ ist klar umrissen: Männerfreundschaft, Sippentreue, Gehorsam gegenüber dem weltlichen wie religiösen Patriarchen – und die Verachtung aller Frauen mit Ausnahme der „Heldenmutter“. Alida Bremer: „Einerseits ist die Frau die Andere, die neue Braut, die sich noch ‚bei uns‘, in unserer Gemeinschaft, bewähren muss. Andererseits ist sie die aufopfernde, die gute Frau. Sie ist die Hausfrau, erzieht die Kinder zu Patrioten und beweist stumme Opferbereitschaft für die Gemeinschaft. In Kriegszeiten ist sie das Objekt, das ‚wir‘ schützen sollen.“
Doch die Stärke der kämpferischen Partisaninnen und emanzipierten Sozialistinnen konnte nicht gänzlich durch die Balkankriege ausgelöscht werden. Heute sind es vor allem weibliche Stimmen, die für Aufklärung und Gerechtigkeit eintreten. Natasa Kandic, die Menschenrechtlerin aus Belgrad zum Beispiel, war sogar während des Krieges im Kosovo unterwegs, um das Geschehen dort zu dokumentieren. „Mich hat man an der Grenze durchgelassen, weil ich Serbin bin“, erzählt sie. Die Serbin befragte, zum großen Erstaunen der Albaner, Familien und Dorfgemeinschaften nach erlittenem Unrecht und Verbrechen. Nicht minder bemerkenswert ist der Einsatz von Flora Brovina: Die kosovo-albanische Ärztin setzte sich anfangs sogar noch in dem serbischen Gefängnis, in dem man sie festhielt und folterte, für serbische Vertriebene aus dem Kosovo ein.
Die Belgrader „Frauen in Schwarz“ trugen – ein Mut, der kaum zu überschätzen ist! – während ihrer Proteste gegen den Krieg und gegen die Unterdrückung der Kosovaren Plakate mit der Aufschrift: „Albanke su nase sestre“ – Albanerinnen sind unsere Schwestern. Und im Belgrader „Centar za zenske studije“ (Zentrum für Frauenforschung) gehen Soziologinnen und Historikerinnen Phänomenen wie der Popularität von „Arkan und Ceca“ nach. Und die Forscherin Marina Blagojevic arbeitet derzeit an einer „Landkarte der Misogynie in Serbien“.
Rada Ivekovic, in Paris lebende kroatische Philosophin, stellt illusionslos fest: „Es hat sich gezeigt, dass der Erfolg der Identitätsbewegungen – der Nationalismen, Fundamentalismen, der rechten Extremismen, ja auch der Kriege – nur dank der Männerbünde, der patriarchalen Strukturen möglich ist.“
Gerade jetzt wollen diese ex-jugoslawischen Nachkriegsgesellschaften beweisen, wer sie als „Nation“ überhaupt sind. Fernsehsender vermitteln „Nationalismus light“ und zeigen stundenlang Trachtentänze, Volksfeste, Folklore. Gleichzeitig aber ist Emanzipation auch auf dem Balkan nicht aufzuhalten.
Im Sommer 2001 traf ich in einem Bergdorf südwestlich des kosovarischen Ortes Djakova die zwölfjährige Kosovo-Albanerin Shpresa. Die begabte Schülerin wollte aufs Gymnasium. In der Stadt hatte sie Computerspiele kennen gelernt, im Radio hörte sie Madonna-Songs. An den Wänden hingen gerahmte Fotografien von verwandten UCK-Kämpfern, Jungen noch, die ihr Leben im Kosovo-Krieg gelassen hatten, und ihre alte Großmutter, in weiten Pumphosen und Kopftuch, konnte über den Berufswunsch ihrer Enkelin nur lachen: „Du? Na, du bleibst hier und hütest die Hühner!“
Das Mädchen, in buntem T-Shirt und Jeans, blickte zu Boden. Es war ihr alles peinlich. Die Großmutter zu enttäuschen. Vor den Gästen blamiert zu werden. Überhaupt da zu sein, in diesem Augenblick. Shpresas lebt zwischen zwei Welten, die beide an ihr ziehen. Und sie lebt zwischen zwei Epochen. Auf ihren eigenen Mut – und auf die Unterstützung von uns Frauen in Westeuropa – kommt es jetzt an.
Caroline Fetscher, EMMA März/April 2003