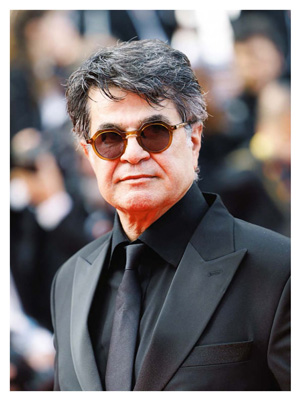Revolution in Karlsruhe
Man darf es wohl mit Fug und Recht als Revolution bezeichnen, was die RichterInnen des Bundesverfassungsgerichtes da jüngst in Sachen Homo-Ehe verkündeten, zumal der höchstrichterliche Umsturz nicht nur Homos angeht, sondern auch Heteros. Denn eigentlich geht es bei dem Spruch aus Karlsruhe gar nicht vorrangig darum, ob die betriebliche Hinterbliebenenversorgung des Öffentlichen Dienstes künftig auch an Eingetragene LebenspartnerInnen ausgezahlt werden muss. Vielmehr haben sich die sieben Richter und die eine Richterin des Ersten Senats erlaubt, sich grundsätzlich zum Wesen der Ehe zu äußern – und dabei nichts Geringeres postuliert als die Aufhebung der Geschlechterrollen.
Bei diesem Urteil geht es um Egalität – zwischen Heterosexuellen & Homosexuellen, zwischen Frauen & Männern, kurz: zwischen Menschen. Und das ist unbezahlbar.
Aber von vorn: Ein 55-jähriger Beamter aus Hamburg hatte sich durch die Instanzen geklagt. Neben seiner Beamtenpension hat er bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) eine zusätzliche Altersrente abgeschlossen. Im Falle seines Todes hätte sein Lebensgefährte, mit dem er seit acht Jahren „verpartnert“ ist, zwar Anspruch auf Hinterbliebenenrente aus der Pension, denn der ist auch gleichgeschlechtlichen Paaren gesetzlich garantiert. Eine Rente aus dem Zusatzvertrag aber verweigerte die VBL. Die, so die Begründung, stehe nur Ehepaaren zu.
Das sahen die Karlsruher RichterInnen nun anders. Sie sprachen dem Kläger den Anspruch auf Hinterbliebenenrente zu. Aber nicht nur das: Karlsruhe erklärte all jenen, die immer wieder auf das so genannte „Abstandsgebot“ zwischen Hetero- und Homo-Ehe pochen, dass es diesen Abstand gar nicht geben muss. Es sei „verfassungsrechtlich nicht begründbar“, so die Urteilsbegründung, „aus dem besonderen Schutz der Ehe abzuleiten, dass andere Lebensgemeinschaften im Abstand zur Ehe auszugestalten und mit geringeren Rechten zu versehen sind“.
Will heißen: Nur weil Ehe und Familie laut Verfassung geschützt gehören, sind andere Lebensgemeinschaften nicht weniger schützenswert. Im Klartext: Zwischen Hetero- und Homo-Ehe besteht de facto kein Unterschied.
Das hatte Karlsruhe schon einmal erklärt, nämlich den Landesregierungen von Bayern, Sachsen und Thüringen. Die hatten im Jahr 2001 gegen das „Lebenspartnerschaftsgesetz“ geklagt. Das Gesetz sei verfassungswidrig, hieß es in der so genannten „Normenkontrollklage“. Denn: Aus Artikel 6 der Verfassung („Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“) ergebe sich das besagte „Abstandsgebot“. Die „Institutsgarantie“ der Ehe sei in Gefahr, wenn der Staat ein zweites „Institut“ für gleichgeschlechtliche Paare einrichte. Dieser verqueren Logik erteilte Karlsruhe schon damals eine Absage und erklärte: „Die Ehe wird durch das Gesetz weder geschädigt noch sonst beeinträchtigt. Dadurch, dass die Rechte und Pflichten der Lebenspartner in weiten Bereichen denen der Ehegatten nachgebildet sind, werden diese nicht schlechter als bisher gestellt und auch nicht gegenüber Lebenspartnern benachteiligt.“Anders gesagt: Man nimmt den Hetero-Paaren nichts weg, wenn man den Homo-Paaren etwas gibt. Ergo: „Das Förderungsgebot des Artikel 6 kann nicht als Benachteiligungsgebot für andere Lebensformen als die Ehe verstanden werden.“
Die Herren Stoiber, Biedenkopf und Vogel und mit ihnen alle anderen Hüter der Geschlechterordnung schäumten. Aber das konnte die rot-grüne Mehrheit nicht davon abhalten, die „Eingetragene Lebenspartnerschaft“ sukzessive mit immer mehr Rechten auszustatten. Und wenn das Parlament es nicht tat, übernahmen es die Gerichte, die fast durchgängig pro Gleichstellung entschieden und den klagenden Homo-Paaren Trennungszulagen oder Ortszuschläge zusprachen.
Die Frauen- und Männerpaare, die am 1. August 2001 in Deutschlands Standesämtern die Eingetragene Partnerschaft fürs Leben eingingen, hatten damals noch kleine Rechte und große Pflichten: Sie durften einen gemeinsamen Namen tragen, ausländische PartnerInnen erhielten ein Aufenthaltsrecht und nach dem Tod eines Partners/einer Partnerin konnte der/die andere nicht mehr aus der gemeinsamen Wohnung geworfen werden, denn er/sie konnte in den Mietvertrag eintreten. Im Gegenzug waren die PartnerInnen einander zum Unterhalt verpflichtet, auch ihre Einkommen wurden herangezogen, wenn der/die andere staatliche Leistungen wie Arbeitlosengeld beziehen musste. Steuerliche Vergünstigungen gab es dagegen keine.
Dennoch nannte Edmund Stoiber den 1. August 2001 einen „schwarzen Tag für die Familien“ und verwehrte bayerischen Homo-Heiratswilligen gar die öffentliche Verpartnerung auf dem Standesamt. Stattdessen schickte er sie ins stille Kämmerlein zum Notar. Weitere sieben Bundesländer pochten ebenfalls auf ein zeremonielles „Abstandsgebot“ – und verbannten Frauen- und Männerpaare aufs Einwohnermeldeamt.
Doch es nützte alles nichts: Im Laufe der letzten Jahre wurde der Abstand zwischen Ehe und Homo-Ehe immer kleiner. Bund, Länder und Institutionen ergänzten die Rechte der Eingetragenen LebenspartnerInnen von der „Familienmitversicherung“ der Partnerin/des Partners in der Krankenkasse bis zum Erbschaftsrecht. Die Novellierung des Lebenspartnerschaftsgesetzes am 1. Januar 2005 fegte dann nahezu alle noch bestehenden Unterschiede vom Tisch: Für Frauen- bzw. Männerpaare gilt nun gleiches Recht bei der Rente, sprich: Beim Tod ihrer Partnerin erhält die Hinterbliebene 70 Prozent der Rente ihrer Frau. Homosexuelle, die sich trauen, können dies als Zugewinngemeinschaft tun. Sie können sich, falls gewünscht, sogar vorher verloben.
Außerdem wagte sich Bundesjustizministerin Zypries (SPD) an das heißeste Eisen in Sachen Homo-Ehe: die Kinder. Sie trug damit einer Tatsache Rechnung, die von Konservativen bis heute beständig geleugnet oder ignoriert wird: Längst leben in gleichgeschlechtlichen Haushalten oft nicht nur zwei Frauen oder zwei Männer, sondern auch deren Nachwuchs. Sei es, dass er einer vorherigen Beziehung entstammt; sei es, dass die Entstehung des Sprösslings unter Mitwirkung einer holländischen Samenbank oder eines solidarischen Freundes vonstatten ging. Seit 2005 nun kann eine Partnerin die leiblichen Kinder der anderen adoptieren, dito ein Partner die seines Lebensgefährten.
Wieder schrie Bayern um Hilfe und reichte eine weitere Normenkontrollklage in Karlsruhe ein. Diesmal zogen die Verteidiger der Vater-Mutter-Kind-Familie als Keimzelle des Staates unter Führung von Horst Seehofer (ausgerechnet) ihre Klage allerdings freiwillig wieder zurück. Die damalige Justizministerin hatte im Mai 2009 eine Studie des Bamberger(!) „Staatsinstituts für Familienforschung“ präsentiert, die – wie viele andere Studien zuvor – belegte: Kinder, die in gleichgeschlechtlichen PartnerInnenschaften aufwachsen, sind nicht von schlechten Eltern.
„Die Untersuchung hat bestätigt: Dort, wo Kinder geliebt werden, wachsen sie auch gut auf. Entscheidend ist eine gute Beziehung zwischen Kind und Eltern und nicht deren sexuelle Orientierung“, erklärte Zypries und fuhr fort: „Wir sollten daher nicht auf halbem Wege stehen bleiben und jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen für eine gemeinsame Adoption durch Lebenspartner schaffen.“ Das hätte sich die Ministerin allerdings früher überlegen müssen, so kurz vor der Wahl war es zu spät.
Und nach der Wahl? Die FDP, die im Wahlkampf noch „ein gemeinsames Adoptionsrecht für Lebenspartner“ gefordert hatte, schlug das Erbe aus: Im Koalitionsvertrag herrscht zum Adoptionsrecht wie überhaupt in Sachen Homo-Ehe Schweigen. Auch von der „Beseitigung der rechtlichen Nachteile im Steuerrecht“, ebenfalls einst eine Forderung der Liberalen, ist nicht mehr die Rede.
Dafür hat jetzt das Bundesverfassungsgericht gesprochen. Und damit die (weh)klagenden PolitikerInnen aus Bayern und anderswo die Sache mit dem Abstandsgebot diesmal auch wirklich verstehen, haben die RichterInnen es diesmal noch etwas ausführlicher erklärt: Dem gebetsmühlenartig vorgetragenen Argument der Konservativen, der „Abstand“ zwischen Hetero- und Homo-Ehen bestehe darin, dass homosexuelle Lebensgemeinschaften schließlich „nicht auf Kinder angelegt“ seien, hielt das Gericht die Realität entgegen: „In zahlreichen eingetragenen Lebenspartnerschaften leben Kinder, insbesondere in solchen von Frauen.“
So ist es. Auf 30.000 bis 35.000 schätzt der Familienforscher Bernd Eggen vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg die Zahl der Kinder, die in einer „Regenbogenfamilie“ aufwachsen. Und auch dem konstruierten Dualismus – hier die egoistischen kinderlosen Homosexuellen, dort die treusorgenden kinderreichen Heterosexuellen – erteilten die RichterInnen eine Absage via Realitätsabgleich: „Nicht in jeder Ehe gibt es Kinder. Es ist auch nicht jede Ehe auf Kinder ausgerichtet. Ebenso wenig kann unterstellt werden, dass in Ehen eine Rollenverteilung besteht, bei der einer der beiden Ehegatten deutlich weniger berufsorientiert wäre.“ Denn: Die „Versorgerehe“ sei in der gesellschaftlichen Realität „nicht mehr typusprägend“.
Und so zogen die RichterInnen ein unmissverständliches Fazit. „Tragfähige sachliche Gründe für eine Ungleichbehandlung“, erläuterten sie, „ergeben sich nicht aus einer Ungleichheit der Lebenssituationen von Eheleuten und Lebenspartnern“. Kürzt man die Verneinungen aus diesem Satz weg, lautet das Ergebnis: Homosexuelle und heterosexuelle Partnerschaften müssen gleich behandelt werden, weil sie gleich leben. Was, wie die RichterInnen klar erkannten, seine Ursache vor allem darin hat, dass sich die Geschlechterrollen auch in heterosexuellen Ehen zusehends auflösen.
Bleibt also nur noch die Sache mit den Steuern und die mit dem Adoptionsrecht. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich einer oder eine auch für diese Rechte durch die Instanzen klagt. Dann muss womöglich Karlsruhe nochmal ran. Und diesmal dann hoffentlich zum letzten Mal.
Weiterlesen
Von der Latzhose bis L-Word (4/06)
Nur Paar oder auch Familie (4/04)
Sie dürfen sich jetzt trauen! (5/01)
Lesbenehe? (7/84)