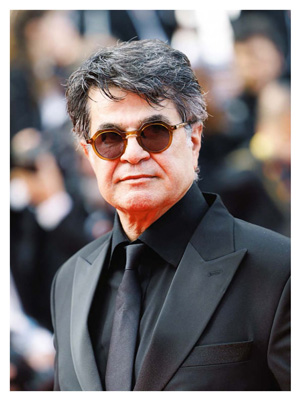Der lange Marsch der Ärztinnen in den Berufsstand
Im 19. Jahrhundert mussten die ersten deutschen Ärztinnen noch in der Schweiz studieren - heute ist Frau Doktor bei den PatientInnen beliebter als Herr Doktor. Und der Ärztinnenbund ist nicht unschuldig bei der Ernennung von Professorinnen.
Der Herr Doktor war nicht nur außer sich, er argumentierte auch erstaunlich offen: Er habe „zu viele Söhne zu versorgen, um jemals den Erfolg von Frauen im medizinischen Berufe begünstigen zu können“. Mit den Worten beschied der Professor an der medizinischen Fakultät Edinburgh anno 1869 das Gesuch von Sophia Jex-Blake und vier ihrer Kommilitoninnen abschlägig. Sie hatten den Zugang zu den Sälen der „Royal Infirmery“ gefordert, um dort die Medizin nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis studieren zu dürfen. Was Frauen streng verboten war.
Rund 40 Jahre später geriet auch der deutsche Medizinhistoriker Julius Pagel an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Angesichts der Tatsache, dass um die Jahrhundertwende erste unverfrorene Frauenzimmer die Ausübung des Arztberufes beabsichtigten, äußerte er den dringenden Wunsch, dass „diese ganze absonderliche Bewegung bald der Vergangenheit angehört“. Sorry, Julius. Dumm gelaufen.
Die Zeiten und die Zahlen haben sich geändert. Und zwar gewaltig. 40 Prozent aller deutschen Ärzte – fast 150.000 - sind heute Ärztinnen. Tendenz steigend: Jeder zweite Medizinstudent ist eine Studentin, und im Wintersemester 2001 betrug die Zahl weiblicher Erstsemester sogar 61 Prozent. „Ärztin“ steht auf der Berufs-Hitliste von Gymnasiastinnen auf Platz zwei, bei den Jungs ist der „Arzt“ noch nicht einmal mehr unter den Top Ten. Was möglicherweise daran liegt, dass der Berufsstand nach der Gesundheitsreform voraussichtlich nicht mehr ganz so satt verdienen wird.
Fakt ist: Ärztinnen sind bei PatientInnen beliebter als ihre männlichen Kollegen. Laut einer aktuellen Studie des Berliner Benjamin-Franklin-Uniklinikums gehen Ärztinnen „partnerschaftlicher“ mit ihren PatientInnen um. „Sie stellen mehr Fragen und geben mehr Informationen.“ Eine amerikanische Untersuchung bestätigt: Weibliche Mediziner sind „patientenzentrierter“, haben „weniger Scheu vor psychosozialen Themen“ und beziehen öfter „einen größeren Lebenskontext in ihre Gespräche ein“. Fazit: Viele Patienten wünschen sich, dass „mehr Frauen den Arztberuf ergreifen“. Das tun sie.
Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein weigerten sich die deutschen Medizin-Fakultäten, Frauen Zutritt zu ihren Heiligen Hallen zu gewähren. „Die Überladung des ärztlichen Standes mit unbefähigten halbgebildeten weiblichen Handwerkern hemmt und stört die Fortbildung der ärztlichen Wissenschaft und Kunst auf das schädlichste“, hieß es. Und der bereits zitierte Julius Pagel erklärte: „Nur in einer Beziehung ist für mich die ‚Ärztin‘ diskutabel: nämlich als Helferin für die Krankenküche.“
Also absolvierten die ersten deutschen Ärztinnen, Franziska Tiburtius (1843-1927) und Emile Lehmus (1841-1932) ihr „Studium der Medicin“ in der benachbarten Schweiz. Tiburtius, die zunächst als Lehrerin gearbeitet hatte, bevor sie sich zum „Sprung ins absolute Dunkle“ entschloss, erzählte nur Mutter und Bruder – der sie zum Studium ermutigt hatte - von ihrem ungeheuerlichen Vorhaben. Die Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. 1876 hatten die beiden Pionierinnen ihren Doktortitel in der Tasche und verließen Zürich in Richtung Berlin, um dort als niedergelassene Ärztinnen zu arbeiten. Dort wurden Dr. Tiburtius und Dr. Lehmus nicht nur Steine in den Weg gelegt, sondern, wie Franziska Tiburtius in ihren Lebenserinnerungen schreibt, gleich ein „großer Felsblock“.
Die Approbation wurde ihnen verweigert. Schließlich sei der Titel im Ausland erworben. Zwar durften die Ärztinnen in ihren Praxen, die sie in ihren Wohnungen eröffnet hatten, Frauen und Kinder gewissermaßen als Privatsache behandeln. Rezepte, Geburts- und Totenscheine auszustellen, war ihnen hingegen verboten. Ein Jahr nach ihrer Ankunft in Berlin eröffneten die beiden Arbeits- und wohl auch Lebensgefährtinnen in einer Hinterhofwohnung in der Alten Schönhauser Straße die „Poliklinik weiblicher Ärzte für Frauen und Kinder“. Dort behandelten sie zweimal pro Woche Fabrikarbeiterinnen, Dienstmädchen und andere arme, oftmals unverheiratete Patientinnen. Die kamen in Scharen, und die beiden Ärztinnen versorgten sie „bis in die sinkende Nacht“.
Bald darauf wurde die „Klinik weiblicher Ärzte“ um eine Pflegestation und einen Operationsaal erweitert und damit zum einzigen Ort Berlins, an dem weibliche Ärzte hospitieren und praktizieren konnten.
Die Attacken der männlichen Ärzteschaft gegen das offensiv frauenrechtlerische Pionierinnen-Paar ließen nicht lange auf sich warten: Die Witzblätter Kladderadatsch und Ulk hämten über die beiden Ärztinnen. Und Dr. Tiburtius flatterte doch allen Ernstes eine anonyme Klage wegen unrechtmäßigen Führens des Doktortitels ins Haus. Im Jahr 1900 – die Zahl der in Berlin praktizierenden Ärztinnen war auf sieben gestiegen - erhob ein Berliner Universitätsprofessor Massenklage gegen alle niedergelassenen Ärztinnen mit ausländischem Diplom. Sie wurde abgewiesen.
Ein Jahr nach der abgewiesenen Massenklage, nämlich 1901, ließ der erste Staat des Deutschen Reiches, nämlich das Großherzogtum Baden, deutsche Frauen unter dem Druck der Historischen Frauenbewegung endlich zum Medizinstudium zu. Erst 1909 durften Frauen dann im gesamten Deutschen Reich Ärztinnen werden. Bis 1918 legten 750 Studentinnen ihr Staatsexamen ab und bekamen ihre Approbation als Ärztin.
Seit sich die allererste Frau in Deutschland das Recht, als Ärztin zu arbeiten, erkämpft hatte, waren genau 176 Jahre vergangen. Hiltrud Schröder schreibt über diese frühe Pionierin: "Im Mai 1754 verabschiedet sich in Quedlinburg die 39-jährige Dorothea Erxleben von ihrem Ehemann und ihren Kindern. Sie ist auf dem Weg nach Halle zur Universität, um die Doktorwürde der medizinischen Fakultät zu erlangen. Mit diesem akademischen Examen will sie ihren guten Ruf als Ärztin verteidigen, den ihr Kollegen in der Heimatstadt strittig gemacht hatten. Sie war der Kurpfuscherei bezichtigt worden. Von Kindheit an war sie von ihrem Vater, dem Arzt Christian Leporin, in die Heilkunde eingewiesen worden. Wie ihre Brüder hatte er sie unterrichtet, zu den Kranken mitgenommen; wegen ihres außerordentlichen Geschicks liess er sich sogar von ihr in seiner Praxis vertreten. Um aber approbierte Ärztin zu sein, musste Dorothea studiert haben. Die Universitäten ließen aber damals Frauen zum Studium nicht zu. Dorothea Erxleben wehrte sich zunächst mit der Schrift 'Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studiren abhalten' (erschienen 1742) gegen die Vorurteile ihrer Zeit. Und sie setzte beim preussischen König Friedrich dem Großen durch, dass 1741 die Universität Dorothea Leporin zur Promotion zuließ. In der Zwischenzeit heiratete sie den Diakon Johann Christian Erxleben in Quedlinburg, einen Witwer mit fünf Kindern, mit dem sie noch vier gemeinsame Kinder hat. Trotz des großen Haushaltes erweitert sie durch Fachstudien und praktische Tätigkeit ihr medizinisches Wissen. Ihre Heilerfolge erregen den Neid der Kollegen. Um den Anfeindungen zu begegnen, entschließt sich Dorothea kurz nach der Geburt ihres vierten Kindes zur promotion und legt 1754 mit großen Erfolg die Prüfung ab."
Die Ärztinnen, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben an der Front riskieren durften, kannten vermutlich den Namen Erxleben noch nicht einmal mehr. Ab 1920 konnten sich Ärztinnen, denen eine Universitätskarriere bis dato versperrt gewesen war, schließlich auch habilitieren. In der Weimarer Republik stieg die Zahl der Ärztinnen beständig an, wenngleich ihre Aufgabe vorwiegend im Arbeitsfeld „Familie“ gesehen wurde: Körperhygiene, Kinderpflege, Ernährungsberatung. Etwa 2.500 weibliche Ärzte praktizierten Mitte der 20er Jahre in Deutschland. Und sie begannen, sich zu organisieren.
Am 25. Oktober 1924 gründeten 40 Delegierte in Berlin den Bund Deutscher Ärztinnen. Ziele des Bundes: „1. Zusammenschluss der Ärztinnen Deutschlands, 2. Bearbeitung sozialhygienischer Aufgaben vom Standpunkt der Ärztin als Frau, 3. Ausarbeitung von Vorschlägen für die sozialhygienische Gesetzgebung, 4. Sorge für die nicht mehr arbeitsfähigen älteren Kolleginnen und Unterstützung der jungen Medizinierinnen“. In ihrer Verbandszeitung „Die Ärztin“ fochten die aufrührerischen Ärztinnen nicht nur für die Verbesserung der Schulhygiene, sondern auch für eine Reform des § 218 und die Förderung des Frauensports.
Vorsitzende des Bundes wurde Hermine Heusler-Edenhuizen. Die Frauenärztin, die zu den ersten 30 in Deutschland approbierten Ärztinnen gehörte, hatte an Tiburtius‘ und Lehmus‘ „Klinik weiblicher Ärzte“ als Chirurgin praktiziert und später ein Heim für unehelich schwangere Mädchen gegründet. Selbstverständlich war an diesem 25. Oktober auch Franziska Tiburtius anwesend. Die mittlerweile 81-jährige Pionierin, die so vielen ihrer Nachfolgerinnen den Weg geebnet hatte, wurde zum Ehrenmitglied ernannt.
1933 hatte der Bund deutscher Ärztinnen stolze 900 Mitglieder – mehr als ein Viertel der mittlerweile 3.400 praktizierenden deutschen Ärztinnen. Wie alle Aufbrüche der Frauen, wurde auch der der Medizinerinnen von den Nationalsozialisten hart gebremst. Bereits im März 1933, wenige Wochen nach der Machtergreifung, verkündete der Gynäkologe Dr. Albert Niedermeyer in den Ärztlichen Mitteilungen: „Gerade das Frauenstudium ist eine der schwersten Krankheiten am Volkskörper“ und ließ die Pläne der Männerbündler schon deutlich ahnen: „Die Tatsache, dass bisweilen Ärztinnen eine sehr gute Praxis haben, beweist nicht deren Notwendigkeit.“
Gleichzeitig stellten die Nationalsozialisten den Ärztinnenverband vor die Alternative, sich entweder aufzulösen oder „gleichzuschalten“. Der Bund deutscher Ärztinnen entschied sich für die Gleichschaltung – und schloss bis Ende 1933 seine jüdischen und halbjüdischen Mitglieder aus.
Der Auflösung entkam er damit nicht: 1937 wurde die „Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen“ erlassen. Sie enthielt nicht nur ein Berufsverbot für „nichtarische“ ÄrztInnen und solche, die „nicht rückhaltlos für den nationalsozialistischen Staat eintreten“. Auch „verheiratete weibliche Ärzte“ verloren ihre Zulassung, wenn „die Ausübung der kassenärztlichen Tätigkeit zur wirtschaftlichen Sicherstellung der Familie nicht erforderlich scheint“. 1936 beschied die neue „Reichsärzteordnung“, dass berufspolitische Verbände von nun an überflüssig seien: Der Bund Deutscher Ärztinnen wurde aufgelöst.
Schon in den ersten Nachkriegsjahren begannen die Ärztinnen mit dem Wiederaufbau ihrer Organisation. Das demokratische Westdeutschland boykottierte weibliche Ärzte, indem es ihnen die Anerkennung als Kassenärztinnen verweigerte: Unverheiratete Ärztinnen wurden nicht zugelassen, weil sie keine Familie zu versorgen hatten. Verheiratete auch nicht, weil für das Familieneinkommen schließlich ihre Ehemänner sorgten. So wird im März 1950 in München der Deutsche Ärztinnenbund gegründet, der sich prompt in die Diskussion um den § 218 und den Gleichberechtigungsartikel im Grundgesetz einmischt.
Auf seinen zweijährlichen Kongressen widmen sich die Medizinerinnen seither jeweils einem Schwerpunktthema – und sind ihrer Zeit damit meist weit voraus. So beschäftigte sich der Berliner Ärztinnen-Kongress schon im Jahr 1953 mit „Frauenarbeit und Gesundheit“. Bereits 1967 stellen sie in Goslar die Frage nach „Wirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten“ im Zusammenhang mit weiblichen Hormonen. Und schon vor vier Jahren stellte der Ärztinnenbund in Gießen die Frage: „Schlagen Frauenherzen anders?“
Doch zurück zur Nachkriegszeit: Die Ärztinnen begannen aufzuholen. Anfang der 70er setzt mit der zweiten Frauenbewegung die Kritik an den „Halbgöttern in Weiß“ ein. Der Ruf nach mehr weiblichen Ärzten, insbesondere Gynäkologinnen, ertönt. Er wird langsam, aber sicher erhört: Ende der 70er Jahre war jeder fünfte Arzt in der BRD eine Ärztin.
In der DDR holten die weiblichen Ärzte ihre männlichen Kollegen sogar ein: Vor der Wiedervereinigung stellten Frauen in Ostdeutschland fast 54 Prozent der Ärzteschaft – im Westen waren es 29 Prozent. Die hausärztliche Versorgung lag mit zwei Dritteln Ärztinnen gar überwiegend in Frauenhand. „Die Situation in der DDR hat gezeigt, dass Medizin ein Frauenfach sein kann und dass das mit den Rahmenbedingungen zusammenhängt“, sagt Dr. Astrid Bühren, Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes heute. „Dort gab es eine flächendeckende ganztägige Kinderbetreuung, so dass Ärztinnen auch in den zeit- und dienstintensiven operativen Fächern keine Ausnahme waren.“ Außerdem, mit Verlaub: Der Ärzteberuf war in den sozialistischen Ländern ökonomisch lange nicht so attraktiv wie für die Freiberufler im Westen.
Seit der Wende schließt sich die Schere zwischen Ärztinnen in Ost (49 % im Jahr 2002) und West (38 %). Und es verwundert nicht, dass sich nur jede dritte Ärztin für den aufreibenden (Schicht)Dienst im Krankenhaus entscheidet. Die anderen ziehen eine eigene Praxis oder die Arbeit in einer Behörde vor. Die ist entschieden familienkompatibler - aber auch weniger karriereträchtig.
Was sich höherenorts bemerkbar macht. Zwar haben die Medizinstudentinnen ihre männlichen Kommilitonen mittlerweile zahlenmäßig eingeholt. Aber, wie es das Deutsche Ärzteblatt diplomatisch ausdrückt: „Bei den höheren akademischen Graden schwindet die Frauenmajorität.“ Und zwar gewaltig. Von den rund 14.000 deutschen Chefärzten ist nur knapp jeder zehnte eine Frau, im „Männerfach“ Chirurgie ist sogar nur jede hundertste leitende Stelle mit einer Ärztin besetzt.
Immerhin ist unter den jährlich habilitierenden Medizinern inzwischen jeder achte weiblich, aber nur knapp drei Prozent der sogenannten C4-Professuren – deren InhaberInnen zum Beispiel über Forschungsschwerpunkte entscheiden - haben Frauen inne. Wird ausnahmsweise eine solche Professur mit einer Frau besetzt, knallen in der Kölner Geschäftsstelle des Deutschen Ärztinnenbundes die Sektkorken. In den letzten Jahren hatte das 2.500-köpfige, äußerst rührige Medizinerinnen-Netzwerk des öfteren Grund zum Feiern.
1999 gleich zweimal: Als erster weiblicher Arzt wurde Prof. Dr. Gabriele Nöldge-Schomburg an der Universität Rostock auf einen Lehrstuhl für Anästhesie berufen. Einige Monate später folgte Prof. Dr. Marion Kiechle als erste Frau auf einem Lehrstuhl für Frauenheilkunde (!). Ein Jahr später folgte Dr. Doris Henne-Bruns dem Ruf nach Ulm auf eine Professur in Transplantationschirurgie. Und im Februar 2002 besetzten auch die Pathologen der Universität Halle eine C4-Professur mit einer Ärztin, Prof. Dr. Ruth Knüchel-Clarke.
Champagner dürfte geflossen sein, als im vergangenen Dezember am Deutschen Herzzentrum in Berlin der Lehrstuhl „Frauenspezifische Gesundheitsforschung mit Schwerpunkt Herz-Kreislauferkrankungen“ eingerichtet und Prof. Dr. Vera Regitz-Zagrosek auf diese Professur berufen wurde.
Meist ist der Ärztinnenbund an solchen Berufungen nicht ganz unbeteiligt. Die Medizinerinnen wissen, dass neben Top-Qualifikation auch Networking notwendig ist, um Hindernisse aus dem Weg zu räumen: Hindernisse wie die undurchsichtigen Berufungsverfahren des Old-Boys-Netzwerks, an deren Ende seltsamerweise stets ein Mann auf dem ersten Listenplatz steht. Oder fehlende Kindertagesstätten in Krankenhäusern. Oder eine Approbationsordnung, in die immer noch keine Gender-Aspekte eingeflossen sind.
So networkt der Ärztinnenbund, der 1999 sein 75-jähriges Bestehen feierte, selbst: Er hat ein Mentorinnen-Netzwerk aufgebaut, vergibt jährlich einen Wissenschaftspreis für eine „gendersensible“ Forschungsarbeit und ehrt seit zwei Jahren eine „Mutige Löwin“ für unerschrockenen Einsatz in Sachen Frauensolidarität.
Im bundesweiten Arbeitskreis Frauengesundheit ist der DÄB ebenso Mitglied wie im Deutschen Frauenrat, gleichzeitig ist Präsidentin Astrid Bühren im Vorstand der Bundesärztekammer. Sie weiß: „Die Männer müssen mit ins Boot.“ Die Präsidentin bedient sich dazu ihrer bewährten Methode: der diplomatischen, aber hochnotpeinlichen Befragung. Wenn sie zum Beispiel auf Kongressen medizinische Vorträge hört, die sich durch das Ignorieren weiblicher Patienten oder Probanden auszeichnen, pflegt sie freundlich zu fragen: „Ich fand Ihren Vortrag ausgesprochen interessant. Und wie ist denn Ihren Ergebnissen zufolge der Unterschied zwischen Frauen und Männern?“ Meistens reißt der Referent erstaunt die Augen auf. „Und dann weiß ich: Ich hab ein Saatkorn gelegt. Und beim nächsten Mal frage ich wieder.“
Astrid Bühren fragte auch 1999 nach, ob denn die vakante C4-Professur für Gynäkologie an der Technischen Universität München wohl mit einer Frau besetzt werde. Als man ihr antwortete, es gebe keine geeigneten Kandidatinnen, befragte die Präsidentin die sämtliche Gynäkologie-Lehrstühle und legte der Berufungskommission eine Liste mit sechs hochqualifizierten Kandidatinnen vor.
Als dann tatsächlich Prof. Dr. Marion Kiechle auf Platz zwei der Berufungsliste gelandet war, hakte Astrid Bühren schließlich per Brief bei Bayerns Kultusminister Hans Zehetmair (CSU) nach. Es sei überfällig, dass ein Lehrstuhl in Frauenheilkunde endlich mit einer Frau besetz würde. Ob er sich denn nun für Frau Kiechle entscheiden würde? Der Kultusminister sagte Ja.
Von nichts kommt nichts. Astrid Bühren hat ihre ganz persönlichen Gründe für ihr Engagement: Auch die 50-jährige Fachärztin für Psychotherapeutische Medizin und Mutter von zwei Kindern hat sich jahrelang „immer an der Karriere meines Mannes orientiert“. Fünf Jahre hat sie für die Kinder ausgesetzt, während ihr Mann eine steile Karriere als Unfallchirurg machte. Die Ärztin mit eigener Praxis in Murnau hat selbst erlebt, „dass Ärztinnen ihre Karriere eben nicht so einfach von 25 bis 65 durchziehen können“. Gemeinsam mit dem Deutschen Ärztinnenbund und mit Hilfe der hochnotpeinlichen Befragung arbeitet sie daran, „dass es die nächste Generation Ärztinnen besser hat“.
Die Chancen stehen gut: Knapp zwei Drittel der Studienanfänger im Fach Medizin sind heute Frauen. Eine davon ist übrigens die Tochter von Astrid Bühren. Und so kann es statistisch gesehen eigentlich nicht mehr lange dauern, bis uns die Stimme im Fernsehen rät: „Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Ärztin oder Apothekerin.“
EMMA 5/2003
www.aerztinnenbund.de Weiterlesen
Kristin Hoesch: "Franziska Tiburtius, Emilie Lehmus und Agnes Hacker" (1997, vergriffen).