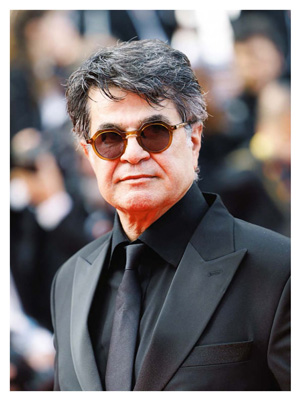Luise Pusch: Die Frauensprachlerin
Als Luise Pusch sieben Jahre alt war, schlug sie einem Schulkameraden zwei Zähne aus. Dabei, sagt sie, sei sie eigentlich „ein liebes, stilles Kind“ gewesen. „Nur bei Ungerechtigkeit wurde ich sehr, sehr wütend.“ Der Junge hatte ein anderes, kleineres Mädchen auf den Boden geschmissen. Ab da lief er mit einer Zahnlücke herum.
1978 war es wieder soweit. Luise Pusch’s Gerechtigkeitsdetektor stand auf knallrot. Die 34-jährige Doktorin der Linguistik hatte sich gerade mit einer Arbeit über das italienische Gerundium an der Universität Konstanz habilitiert. Da veröffentlichte ihre Kollegin, die Sprachwissenschaftlerin Senta Trömel-Plötz, einen bahnbrechenden Aufsatz, in dem sie die Auslöschung der Frau in Sprache und Grammatik anprangerte: „Linguistik und Frauensprache“. Die gesellschaftliche Unterordnung der Frau unter den Mann, so die These, spiegele sich in der Sprache, weshalb beides revolutioniert werden müsse. Die Reaktion der Herren Professoren war so hämisch und vernichtend, dass Luise Pusch der Zorn packte. Zwei Jahre Engagement in der Frauenbewegung taten das ihre dazu. „Da bin ich in die Arena gestiegen.“
Die angehende Professorin, die sich bis dato leidenschaftlich mit der Funktion von „Instrumental- und Modalsätzen“ befasst hatte, tauchte nun ein in die Welt der „femininen Gattungsnomen“ und des „generischen Maskulinums“. Und ihr erschloss sich das Ausmaß der linguistischen Frauenunterdrückung. „Ich fiel von einem Entsetzen ins nächste!“ Diesmal schlägt Luise nicht mit den Fäusten zu, sondern mit Worten. „Ich habe Sentas Kritiker mit Genuss auf den Topf gesetzt.“ Sechs Jahre später, 1984, wird eine Textsammlung von ihr erscheinen, die bis heute als Klassiker der feministischen Linguistik gilt: „Das Deutsche als Männersprache.“
Die schärfste Waffe der Autorin ist in Zeiten, in denen das Substantiv „Feministin“ automatisch im Doppelpack mit dem Adjektiv „verbissen“ auftaucht, neben ihrer profunden Expertise, ihr Humor. Statt trocken zu analysieren, spottet Pusch über „Damenwahl“ und „Herrentorte“, sie zerpflückt Bibelverse, macht aber auch vor den sprachlichen Verirrungen des eigenen Lagers nicht Halt. Über die „Frauen- und Lesbenreferate“, stolze Errungenschaft der Frauenbewegung, schreibt sie: Die Bezeichnung „Frauen und Lesben“ sei eine „absurde Konstruktion, ähnlich wie Südfrüchte und Apfelsinen“.
Zweifellos liegt ein gewisses Sendungsbewusstsein bei Luise Pusch in der Familie, ebenso das Faible für Sprache: Ihr Großvater mütterlicherseits war Missionar. 17 Jahre lang lebte er mit seiner Familie auf Nias, einer Insel vor Sumatra, und verfasste die erste Grammatik der Sprache der Ureinwohner. 1920 kehrte die Familie zurück. Der Großvater starb mit nur 46 Jahren und hinterließ sechs Kinder, „die alle in seine Fußstapfen treten sollten“.
Luises Mutter wird Krankenschwester. Als ein Missionar aus Gütersloh um ihre Hand anhält, hält sie das – auch wenn sie selbst gar nicht gefragt wird - für einen „Fingerzeig Gottes“. „Ich stamme also aus einer völlig blödsinnigen Ehe“, sagt Luise Pusch trocken. Auch die drei Kinder, die nun in der Nachkriegszeit das Licht der Welt erblicken, „sind meiner Mutter aufgezwungen worden. Ihr Verhältnis zu uns war ambivalent“.
Fünf Jahre lang hält die Mutter aus, dann tut sie etwas Ungeheuerliches: Sie lässt sich scheiden. Von nun an wird sie als „Suffragette“ beschimpft. Es ist wenig Geld im Haus, und Tochter Luise, die als 13-Jährige „nur einen einzigen Rock“ besitzt, ist auf dem Mädchengymnasium „sozial das Schlusslicht“. Aber das spornt sie auch an: „Es hieß immer, aus uns Kindern könne ja nichts werden. Und ich wollte zeigen: Aus mir wird doch was!“
In der Tat. Allerdings erfährt Luises Karriere mit ihrer Zuwendung zum Feminismus einen empfindlichen Knick. Sie, die Stipendien und Preise abräumt, wird plötzlich kaltgestellt. „Ich kriegte kein Bein mehr an die Erde.“ Es ist eine späte Genugtuung, dass ihr „Deutsch als Männersprache“ heute mit 140 000 Exemplaren das bestverkaufte sprachwissenschaftliche Werk der Nachkriegsgeschichte ist.
Auf noch einem Gebiet ist Luise Pusch Pionierin: 1981 veröffentlicht sie, damals noch unter Pseudonym, das Buch „Sonja“. Die tragische Geschichte über ihre Beziehung zu einer Mitstudentin im Rollstuhl, die schließlich Selbstmord begeht, ist eine der ersten über eine Frauenliebe. 1986 lernt Pusch bei einer Rundreise durch die USA Joey Horsley kennen. Die Frau von der Ostküste ist praktischerweise Germanistin. „The rest is history“, lacht Pusch, die heute halb in Hannover und halb in Boston lebt. Gemeinsam hat das Paar mehrere Bücher herausgegeben, die Frauen vor dem Verschwinden bewahren sollen. Sie handeln von Müttern, Töchtern und Schwestern berühmter Männer. 2006 hat Luise Pusch das Webportal „Fembio“ ins Leben gerufen, auf dem sie über 8000 Frauenleben vorstellt – von Tori Amos bis Clara Zetkin. Jede Woche veröffentlicht sie eine Glosse über das, was ihr sprachlich so über den Weg läuft. Bei der Prostitution, sagt sie zum Beispiel, wären wir weiter, „wenn wir das, was da passiert, nicht länger als ‚Sex‘ bezeichnen würden. Denn Sex bezeichnet einen für beide Seiten lustvollen Akt.“
Die Linguistin ist als Sprachlehrerin gefragter denn je: Ministerien und Unternehmen bitten um Unterweisung in geschlechtergerechter Sprache. Jüngst war sie bei der Berliner Stadtreinigung, die eine Frauenquote für MüllfahrerInnen eingeführt hat. Ein Fall für Pusch: „Damit die Müllfahrerinnen nicht länger sagen: Ich bin Müllfahrer.“
Nachtrag: In ihrer neuen Glosse kritisiert Luise Pusch, dass sie im Vorspann des Porträts als „Homosexuelle“ bezeichnet wird. Sie hätte „Lesbe“ bevorzugt, denn das sei „eine Selbstbezeichnung und ‚Homosexuelle’ eine Fremdbezeichnung“. EMMA hatte argumentiert: „Spätestens seit dem Kampf ums Homo-Mahnmal haben wir uns angewöhnt, auch Lesben als (weibliche) Homosexuelle zu bezeichnen, weil darunter gemeinhin nur Schwule verstanden werden und das aufhören muss.” Was meint ihr?
Weiterlesen
von Luise F. Pusch: "Gegen das Schweigen" (Aviva), "Gerecht und Geschlecht - neue Sprachpolitische Glossen" und "Die Sprachwandlerin. Zurufe und Einwürfe von Freundinnen und Weggefährtinnen", eine Femmage zum 70. Geburtstag (beide Wallstein Verlag).