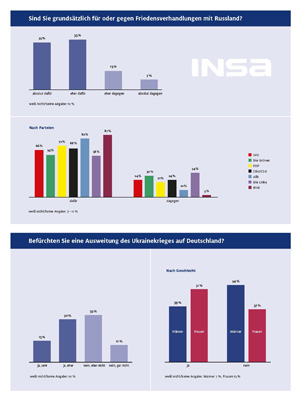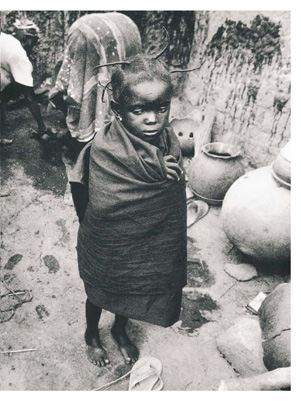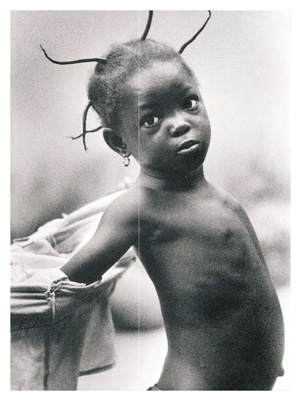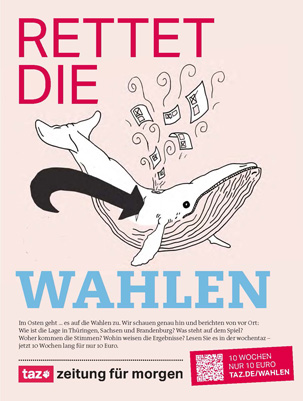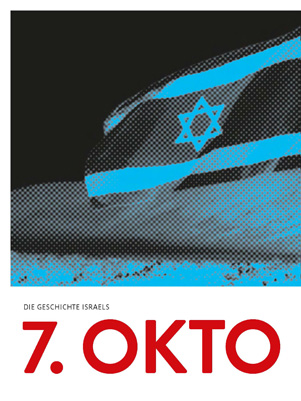Einsame Cowboys
Cheryl Benard und Edit Schlaffer, das bekannte Wiener Forscherinnenduo, wissen doppelt gut, wovon sie reden: Sie sind Mütter von insgesamt drei Söhnen und einer Tochter. Wenn es die neuen Männer geben soll, dann müssen die ja von irgendwoher kommen. Die zwei Frauen haben sich auf die Suche in den Schulen gemacht. „Jungenarbeit“ heißt das Zauberwort.
Mädchen und Jungenarbeit kommt aus dem emanzipatorischen Lager, dahinter stehen Werte wie Chancengleichheit, fairere Arbeitsteilung und Ähnliches. Mäd- chen sollen wehrhafter werden, Buben ihre „weiblichen Anteile“ besser entwickeln. Klischees sollen abgebaut, Individualität soll gefördert werden.
Wie kommen gerade Personen, die solche Werte vertreten, darauf, dass verstärkte Differenzierung und Betonung der biologischen Unterschiede zum Ziel führen? Warum wird die Geschlechts-identität als das primäre Gruppenmerkmal betont, wenn das Ziel darin liegt, traditionelle Trennungen auf dieser Basis abzubauen? Das häufigste Argument in Verteidigung dieses Zugangs ist der Gedanke, man müsse „die Jungen dort abholen, wo sie sind“. Man müsse mit ihnen also zunächst Sport und Kampfspiele betreiben, um ihr Interesse zu gewinnen, und es dann überleiten in andere Inhalte.
Wir haben uns vier Jahre lang die Programme angesehen, die von schulischer Seite und in der Freizeitbetreuung für junge Leute entwickelt worden sind. Es stellte sich schnell heraus, dass Jungen zwar mit großzügigen Sport- und Freizeitangeboten versehen werden, dass sie aber stiefmütterlich behandelt werden, wenn es um ihre persönliche menschliche Entwicklung geht.
In vielen Schulen fanden wir gute Programmangebote oder zumindest hoffnungsvolle und engagiert betriebene Initiativen für Mädchen. Wir fanden Mäd-chengruppen, Mädchenklubs und Mäd- chenschwerpunkte, geleitet von motivierten Lehrerinnen. Und meist fanden diese Lehrerinnen irgendwann, dass es doch auch ein Programm für die Jungen geben sollte. Mitunter konnten sie einen männlichen Kollegen sogar so weit kriegen, dass er sich dieser Sache annahm. Und dieser Kollege entdeckte dann in aller Regel, dass er sich in einem Land ohne Karten befand. Da saß die Jungengruppe vor ihm, flachsend, laut, sich gegenseitig von den Sitzen stoßend, irrsinnig cool – und was genau sollte er nun mit ihnen tun?
In Ermangelung hilfreicher Unterlagen verfiel er meist notgedrungen auf Reserveplan B oder C. Plan B: Er flüchtete in gruppendynamische Übungen, an die er sich erinnerte, weil er sie irgendwann mal in einem Seminar selbst mit-erlebt hatte. Das erwies sich selten als zweckführend und oft als ausgesprochen gefährlich. Plan C: Er machte jene Dinge, die ihm spontan zu Jungen einfielen: zum Beispiel Basketball, Kletterwand oder, im ehrgeizigen Fall, Zelten. „Man muss die Jungs dort abholen, wo sie sind“, begründete er sein Vorgehen. Und war enttäuscht, dass seine Schützlinge aus diesen Übungen weder geläutert, noch sichtlich verändert hervorgingen, dass sich nicht irgendwie magisch eine Selbsterfahrungsgruppe daraus entspann. Weil er sie zwar „abgeholt“ hatte, mit ihnen dann aber nirgendwo hingefahren ist.
Ein solches Handeln nimmt an, dass Jungen eine homogene Gruppe sind, durch gleiche Interessen und Eigenschaften geeint, und dass sie nur im Kollektiv betreut werden können. Diese Annahmen sind beide falsch.
Wie neuere Studien zeigen, sind Jungengruppen erstens weit poröser als sie auf den ersten Blick erscheinen mögen, sind sie zweitens eher das Konstrukt sozialer Zwänge als der inneren Wünsche der Jungen selbst und trifft drittens das traditionelle Jungenverhalten in Wirklichkeit nur auf eine Minderheit zu (aller-dings auf eine auffällige und daher überbewertete Minderheit).
Der – statistisch gesprochen – „normale“ bzw. durchschnittliche Junge entspricht dem Klischeebild nur partiell oder gar nicht. Er spielt gerne mit Mädchen, aber nur dort, wo das sozial gestattet wird, nämlich im Verwandtschaftskreis und in der Nachbarschaft; in der Schule, wo er dafür verspottet werden könnte, ignoriert er sie. Seine Liebe zum Sport ist nur zum Teil eine echte Neigung. Schon in der Volksschule weiß er, dass es für einen Jungen einfach zum guten Ton gehört, Sport zu lieben. Immer und immer wieder konnten wir in Beobachtungen und Studien erkennen, dass die Gruppe, also die Jungengruppe, nicht ihr Hafen, ihre intrinsische Heimat ist, in der sie sich wohl und zu Hause und geborgen fühlen, sondern ihr großes Problem.
Und Jungenarbeiter wollen sie, statt sie von der Gruppe und deren Druck und überholten Gesetzen zu befreien, wieder in diese Gruppe schließen? Nun wollen auch noch die Jungenbetreuer den Jungen vermitteln, dass ein „echter“ Junge sich in erster Linie für Sport interessiert?
Für die verbesserte Interaktion zwischen Mädchen und Jungen ergibt die Jungengruppe ebensowenig Sinn. Wäh-rend man vielleicht noch argumentieren könnte, dass Mädchen die Gruppe zur Stärkung brauchen, trifft dieses Argument für Jungen keineswegs zu. Sie werden zwar in ihrem aggressiven Auftreten, nicht aber in ihrer Identität gestärkt durch die Gruppe. Und „die Gruppe“ hat für Jungen und Mädchen eine grundlegend andere Bedeutung. Für Jungs ist die Gruppe eine Art Rudel, eine kampf-orientierte, hierarchische und Konformi-tät erzwingende Struktur, der sich der Einzelne unterordnen muss. In der Gruppe hat sich jeder für sich zu profilieren, hat Bündnisse zu schließen, seinen Platz zu kennen und seine Individualität zu unter- drücken, falls sie nicht ins Schema passt.
Wie verfahren wir nun mit den Jungen? Versuchen wir, aus ihnen eine zuhörende, tendenziell antihierarchische, zugewandte Gruppe nach Vorbild der Mädchengruppe zu schmieden? Oder geben wir der Überlegung Raum, dass für Jungen die geschlechtshomogene Gruppe an und für sich vielleicht nicht die optimale Form für kritisches Denken und alternatives Handeln darstellt?
Die Gemeinschaft ihrer Geschlechtsgenossen ist eine Diktatur, in der die Jungen leben müssen. Mühsam basteln sie sich einen Habitus zusammen, der es ihnen möglich macht, in dieser Gemeinschaft zu bestehen. Ihr Auftreten, ihre Art zu sprechen, ihre Kleidung, all das ist sorgfältig ausgewählt, um Akzeptanz zu erreichen und Angriffe zu verhindern. Es ist naiv und vollkommen unrealistisch zu erwarten, dass Jungen diesen sorgfältig konstruierten Apparat ablegen werden, um sich plötzlich einander zu öffnen und ihre Ängste und Schwächen zu diskutieren.
Jungen sollten in die Lage versetzt werden, gruppendynamische Abläufe besser zu durchschauen. Welche persön-lichen Probleme und Bedürfnisse stehen hinter einem aggressiven, kasperlhaften, einem cliquenhaften Verhalten? Wie können diese alternativ und besser abgefangen werden? (...)
Dazu gehören auch die unerfreulichen sexuellen und quasi-sexuellen Übergriffe von Jungen auf Mädchen, die in vielen Schulen berichtet werden. Zu den Vorkommnissen, die uns aus öffentlichen Wiener Schulen gemeldet wurden, zählen: ordinäre Graffiti über namentlich genann- te Mädchen in den Toiletten; Beschmieren der Schulbücher und Hefte von Mäd- chen mit extrem ordinären Ausdrücken; körperliche Angriffe auf Mädchen in den WCs, wohin die Jungen ihnen gefolgt waren; Begrapschen der Mädchen einzeln oder durch eine ganze Clique von Jungen, die sich ein einzelnes Mädchen vornahm; Entblößungen der Jungen vor den Mäd-chen; Festhalten der Mädchen und Vortäuschung des Geschlechtsaktes; Stoßen, Schlagen, Bespucken etc. der Mädchen in der Schule oder auf dem Heimweg.
Aus Peinlichkeit und aus Unsicherheit, wie damit umzugehen wäre, entsteht eine häufig erschreckend hohe Toleranz für solche Vorfälle. Die Maßnahmen, die ergriffen werden, bestrafen mitunter die Mädchen: Sie werden zum Beispiel angewiesen, die Pausen in der Nähe des Hausmeisters zu verbringen, damit dieser sie beschützend im Auge behalten kann. Das ist gut gemeint, kommt aber einer unverdienten Freiheitseinschränkung gleich, während die „Täter“ weiterhin das gesamte Terrain beherrschen dürfen. Das Dulden dieser Verhaltensweisen ist für die Mädchen unzumutbar, aber auch für die Jungen keineswegs günstig. (...)
Auch Mädchen haben einen sorgfältig konstruierten Habitus, der ihre Position in der Gruppe festigen soll. Aber die internen Regeln der Mädchengruppe gestatten Vertraulichkeiten, das Zeigen von Schwäche und Verletzbarkeit und den intimen Austausch von Informationen. Die internen Regeln der Jungengruppe gebieten Bluff, eine coole „Über-drüber-Haltung“ und ein ständiges sorgfältiges Bedenken der Rangordnung. Es ist eigentlich klar, dass hier ein anderes Vorgehen geboten ist.
In mittlerweile klassischen Experimenten hat die Sozialpsychologie gezeigt, mit welch erschreckender Automatik auch Gruppen von Kindern und Jugendlichen sofort dem Gesetz der Gruppe gehorchen. In einem Ferienlager gelang es zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit, aus zwei willkürlich zusammengestellten Untergruppen von 14- und 15-Jährigen, die zuvor in Bezug auf soziale Herkunft, Alter und Interessen sorgfältig ausgewählt worden waren, um einander möglichst ähnlich zu sein, rivalisierende Banden zu machen, die bereit waren, einander ernsthaften Schaden zuzufügen.
Für Knaben enthält die Jungengruppe die Gefahr, dass alte Rudelgesetze hoch-leben; für Mädchen, dass sie sich in einen Kreislauf des gegenseitigen Mitfühlens begeben; für beide, dass die Blockbildung mehr trennt als vereint, sie nicht vorwärts bringt, sondern zurückhält.
Von den Jungen wird in Adoleszenzgruppen erwartet, dass sie ihr eigenes Gruppenverhalten zunächst ablaufen lassen, es dann studieren, Muster erkennen, dahinter liegende Abläufe kritisch sehen und sich irgendwann, offenbar in einer spontanen Eigengruppentherapie, einem Wachstums- und Heilungsprozess zuwenden. Von den Mädchen wird erwartet, dass sie nach gebührender Befassung mit den Diskriminierungen wehrhaft werden, sich zu einer schlagkräftigen Truppe formieren und die Welt, zumindest aber die Schulwelt, verändern. In beiden Fällen ist dies eine unglaubliche Überforderung.
Vor allem sehr viele Leiter von Jungengruppen verhalten sich passiv. Sie lassen die Gruppe treiben in dem Glauben, dass „irgendwie“ etwas Konstruktives entstehen werde. Wenn stattdessen nur gestritten und geblödelt wird, wenn sexistische Witze kursieren und Anfeindungen passieren, reagieren sie hilflos.
Während in der Mädchenarbeit zumindest versucht wird - nicht immer gelingt es - die typischen Defizite und Verzerrungen der traditionellen Mädchen- sozialisation aufzuwiegen durch gezielte Gegenangebote, verstärkt die Jungen-
arbeit meist den defizitären Weg. In der Mädchenarbeit wird beispielsweise davon ausgegangen, dass Mädchen zuwenig Selbstvertrauen in technischen Dingen haben oder dass sie körperlich zu zaghaft sind. Es werden ihnen daher Angebote gemacht, die das ausgleichen sollen: Reparaturkurse, Karatekurse usw.
Bei den Jungen wissen wir, dass die Bereitschaft zur körperlichen Veraus-
gabung, der Reiz des Abenteuers und des Risikos sehr ausgeprägt sind. Sie erfordern eigentlich keine weitere Verstärkung. Ihre Defizite liegen im Bereich der Selbstwahrnehmung, der Bereitschaft, eigene Grenzen und die Grenzen anderer Menschen zu erkennen und zu respektieren, ein Innenleben zu entwickeln, Emotionen zuzulassen und Ähnliches.
Sehr oft haben wir in den Jahren unserer Schulbeobachtung miterlebt, dass die Mädchen es den Jungen „ersparen“, die vermeintlich „weiblichen“ Tätigkeiten aus- üben zu müssen. Sie bieten sich freiwillig an, für die Knaben den Tisch abzuservieren, aufzuräumen etc. Hinter dem „Wir können das besser, lasst das lieber“, mit dem die Mädchen ihre Hilfeleistung erklären, schwingt Ambivalenz mit: Sie können es besser, aber das, was sie besser können, ist eine niedrige Arbeit. Ihre Sätze sind nicht vergleichbar mit dem parallelen Angebot der Jungen, für die Mäd-chen ein Computerprogramm zu laden.
Hierin liegt das Dilemma der Jungenarbeit: Auf den ersten Blick erscheint es wenig erhebend, sich die Fertigkeiten der Frauen anzueignen. Wozu auch? Es sind dienende, helfende, emotional mit Schwäche assoziierte Fertigkeiten. Sie können einen lediglich in die Position versetzen, dass man dann Arbeiten verrichten muss, die man gar nicht verrichten will.
Es ist durchaus möglich, diese Barriere zu überwinden, aber es erfordert ein Kon- zept. Und es erfordert auch Zeit, Gewöhnung und Beharrlichkeit. In einer von uns besuchten Schule dauerte es fünf Jahre, bis der Mädchen-Jungen-Tag protestfrei und erfolgreich ablief. Das ist, gemessen an der Tiefe der Einstellungen, nicht wirklich lang. Es erforderte weiterhin die aufrichtige Unterstützung des Lehrkörpers und glaubwürdige Träger.
Viele spätere Beziehungen verlaufen sich in Endloskonflikten über die Frage der Arbeitsteilung zwischen der mehrfach belasteten berufstätigen Frau und dem nur sehr sporadisch „helfenden“ Mann. Dieser Zustand, der viele Ehen prägt und unerfreulich macht, wird nicht haltbar bleiben, da nachrückende Frauengenerationen mehr Partnerschaftlichkeit erwarten. Eine Neutralisierung dieser Arbeiten ist zielführender als das fortdauernde Bemühen, Männer zu willigen „Helfern“ der eigentlich zuständigen Frauen zu machen.
In skandinavischen Schulen wird dies erreicht durch den Schwerpunkt „Selbstversorgung“. Die elementaren Fertigkeiten einer Haushaltsführung werden vermittelt und von den Kindern, da sie sich eine baldige Anwendung im Studentenheim vorstellen können, positiv aufgenommen.
Die gravierendsten Fehler beobachteten wir im Umgang mit den emotionalen Bedürfnissen von Jungen in der Adoleszenz. Zwischen unserem theoretischen und ideologischen Konsens darüber, dass das althergebrachte Bild des gefühlskalten, gepanzerten Mannes nicht mehr gelten soll, und dem realen Umgang mit Jungen in dieser sehr verletzlichen und sensitiven Lebensphase schwebt ein Abgrund. Viel zu früh werden junge Männer aus der Fürsorglichkeit ihrer Erzieher ent- lassen. In einem Alter, in dem sie gefühls- mäßig besonders bedürftig sind, werden sie aus allen verfügbaren Nestern gestoßen.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr Veranstaltungen, die Klischees be-kämpfen wollen, selber ins Klischee fallen. Immer wieder konnten wir miterleben, dass den Mädchen ein kuscheliger Raum für ihre Zusammenkünfte geboten wurde, während die Jungen sich einfach irgendwo auf einen harten, staubigen Boden setzen sollten. Die Botschaft ihrer Betreuer: Ihr seid hart. Ihr kümmert euch nicht um Äußerlichkeiten. Euer wahres Zuhause ist der Holzboden im Turnsaal, der Zementboden im Werkraum. Ein solches Ambiente erzeugt unweigerlich den dazugehörigen Habitus: ungehobeltes Benehmen, rauer Ton.
So mancher angeblich ganz alternative, aufgeschlossene, antisexistische Jugendbetreuer ist in seinem tiefsten Inneren offenbar noch davon überzeugt, dass eine heiße Kanne Tee, ein Teller mit Kuchen und bequeme Sitzgelegenheiten Weiberkram sind. (...)
Weit verbreitet ist auch die Meinung, Jungenarbeit müsse unbedingt von einer männlichen Person geleistet werden. Das ist vielerorts ein gravierender Stolperstein, weil sich kein Mann findet, der diese Arbeit übernehmen möchte oder der sich diese Aufgabe zutraut. Die Konsequenz: Es gibt dann keine Jungenarbeit.
Das typische Bild sieht so aus, dass es einen ausführlichen, von engagierten und aktiven Frauen erkämpften und schließlich durchgesetzten Mädchenschwerpunkt gibt, und als schwachbrüstige Fußnote dazu, anhängselhaft, ein Jungenprogramm. Wenn wir dann die Enstehungsgeschichte studieren, ist die Ursache klar: Nicht das unterschiedliche Interesse der Kinder, nicht die ungleiche Wichtigkeit der Inhalte, nicht die einseitige Kooperation von Schulverwaltung oder Eltern liegen zugrunde, sondern die Mädchenarbeit hat einen starken Motor, und die Jungenarbeit läuft unter „ferner liefen“ mit, weil sie keine vergleichbaren Fürsprecher hat.
Faktum ist in der Adoleszensarbeit, dass sich in vielen Schulen feministische Frauen finden, die dieses Thema für sehr wichtig erachten und bereit sind, sich dafür einzusetzen. Hinter der Mädchenarbeit steht eine soziale Bewegung, die ei-ne Fülle von Studien, Unterlagen und Fortbildungsangebote produziert hat. Dieser Bewegung geht es um eine zeitgemäße, nicht geschlechtsstereotype Interaktion, um eine gleichberechtigte Gesellschaft und einen egalitären Umgang. Die Jungenarbeit hat darin eine natürliche Rolle und Heimat. Aber es gibt anscheinend zu wenig männliche Lehrkräfte, die sich aufgerufen fühlen, die Inhalte zu transportieren. Dem verbreiteten Glaubenssatz zufolge müssen unbedingt Männer Jungenarbeit leisten - aber stimmt das überhaupt? (...)
Die nicht stereotypen Jungen machen einen sehr großen Teil der Jungenpopulation aus. Untersuchungen, die sich speziell hiermit befassen, schätzen ihren Anteil sogar auf 60 bis 70 Prozent. Das Klischee- bild von Männlichkeit lastet unangenehm auf ihnen und vermittelt ihnen das Gefühl, den Anforderungen nicht gerecht zu werden. Und nun soll ihnen auch noch die Jungenarbeit suggerieren, dass sie eigentlich kleine Versager sind, wenn Sport nicht ihr Lebensinhalt ist, sie sich nicht sofort kämpferisch durchsetzen, Mädchen nicht ablehnen und nicht der Anführer einer Rowdybande sind. Das ist fast schon als grausam zu bezeichnen. (...)
Der Junge, der gerne mit Mädchen zusammen ist, wird abgewertet. Die Abwertung stellt sich als sexuelle Schlussfolgerung dar, ist aber unlogisch und muss verworfen werden. Das Ziel kann demnach nur ein soziales sein. Dieser Junge wird abgewertet, weil er sich mit einer abgewerteten Gruppe befasst. Er bricht ein Tabu, aber nicht das Tabu, das ihm vorgeworfen wird. Er bricht das soziale Tabu, das einen sozialen Abstand zwischen den Geschlechtern verlangt. Er gefährdet die Deutlichkeit der Trennung in zwei Geschlechtergruppen, weil er vorführt, dass Mädchen und Jungen gemeinsame Interessen haben, sich miteinander verstehen und unterhalten, ja, sogar befreundet sein können. Das ist in der Altersgruppe der 10- bis 13-Jährigen ein Minderheitenverhalten und verpönt.
Wie uns Lehrer immer wieder bestätigten und wir selbst beobachten konnten, hebt sich die Geschlechtertrennung ab dem Alter von 14 Jahren deutlich auf, die Geschlechtergruppen haben wieder mehr Kontakt miteinander und die Feindseligkeit der früheren „Mädchen-sind-doof“- beziehungsweise „Jungs sind blöd“- Haltung ist weg. Doch nun stehen die Kontakte unter quasi-romantischen Vorzeichen. Jungen und Mädchen interagieren unter dem Aspekt einer möglichen sexuellen Attraktion. Das ist mit zehn noch nicht der Fall. Das macht Kontakte zwischen den Geschlechtern in dieser jüngeren Altersgruppe subversiv - und verlangt nach einer Abschreckung.
Die Abschreckung liegt in dem Wort „schwul“. Mit diesem Begriff ist die Drohung gemeint, unter peinlichen Umständen aus der Jungengemeinschaft ausgestoßen zu werden. Eine Annäherung der Geschlechtsgruppen ist nicht mit dem Hintergrund einer geschlechtsneutralen, auf persönlichen Eigenschaften und Sympathien beruhenden freundlichen Beziehung erwünscht, sondern soll sich auf sexualisiertes Interesse beschränken. Sonst nämlich könnte das ganze Konstrukt, das künstliche Primat der zwei Geschlechterblöcke, zusammenbrechen.
Der Text ist ein Auszug aus „Einsame Cowboys“ (Kösel) von Cheryl Benard und Edit Schlaffer.
EMMA September/Oktober 2000
In EMMA u.a. zum Thema:
Der Stoff, aus dem die Täter sind, Prof. Pfeiffer (4/2002)
Werden aus Erfurt wirklich Lehren gezogen? (4/2002)
Schule & Gewalt (5/2000)
Was ist ein richtiger Junge? (5/2000)
Gewaltzone Schule (2/2000)
Jagd auf Lehrerinnen (1/2000)
Wie Jungen zu Killern gemacht werden, Dave Grossman (1/2000)
Gewalt hat ein Geschlecht, Prof. Pfeiffer (1/2000)
Massaker in Montreal: Kein Zufall (2/1990)
Dieses Thema im Forum diskutieren